Dank eines Stipendiums kommt John Forbes Nash Jr. 1947 an die amerikanische Eliteuniversität Princeton, um höhere Mathematik zu studieren. Es fällt Nash jedoch nicht leicht, sich in Princeton zurechtzufinden: gesellschaftlicher Smalltalk und oberflächliche Nettigkeiten findet er überflüssig, und auch für die Vorlesungen interessiert der Einzelgänger sich herzlich wenig. Er ist von einer einzigen Idee besessen: eine völlig originäre Theorie zu entwickeln. Denn er ist davon überzeugt, dies sei die einzige Möglichkeit für ihn, jemals etwas Bedeutsames zu bewirken. Kurz bevor sein Doktorvater jede Hoffnung für den talentierten jungen Mann aufgibt, gelingt Nash mit einer Forschungsarbeit zum Thema "Spiel- und Entscheidungstheorie" über die mathematischen Prinzipien des Wettbewerbs der Durchbruch, mit dem keiner mehr gerechnet hätte. Dabei steht seine Arbeit im kühnen Widerspruch zur Doktrin von Adam Smith, dem Vater der modernen Wirtschaftswissenschaften. Dieser geniale Coup sichert Nash einen heiß begehrten Posten als Forscher und Dozent am MIT (Massachusetts Institute of Technology), doch ganz zufrieden ist Nash immer noch nicht. Als ihn wenig später der zwielichtige William Parcher im Namen des Pentagon als geheimen Code-Dechiffrierer anwerben will, sagt Nash sofort zu. Er genießt die neue Herausforderung, endlich kann er sein außerordentliches Talent auf die Probe stellen. Fieberhaft durchforstet er fortan die Zeitungen nach geheimen Botschaften der Russen. Seine Ergebnisse steckt er in einen Umschlag, den er nachts in den Briefkasten einer abgelegenen Villa wirft. Neben seiner Geheim-Mission lehrt Nash weiter am MIT. In einer seiner Vorlesung lernt er die schöne und hochbegabte Physikstudentin Alicia kennen und verliebt sich in sie. Was erstaunlicher ist: sie verliebt sich ebenfalls in den verschlossenen, merkwürdigen und hochbegabten Mathematiker, und schon bald heiraten die beiden. Doch das Geheimnis, das Parcher und die Dechiffrierungen betrifft, kann er nicht einmal mit seiner Frau teilen. Immer mehr steigert Nash sich in die Heimlichtuerei und bald schon weiß er nicht mehr, wem er vertrauen kann. Die ständige Gefahr fordert ihren Preis: Nash ist verschlossen, obsessiv und schließlich völlig verloren in einer anderen Welt - Halluzinationen begleiten ihn auf Schritt und Tritt. Unfähig, zwischen Phantasie und Realität zu unterscheiden, steigert er sich immer mehr in seinen Verfolgungswahn. Gibt es Parcher wirklich? Wer sind die Russen, die ihn verfolgen? Und ist der Arzt, der "Paranoide Schizophrenie" bei Nash diagnostiziert, ein Doppelagent?
Bonusmaterial
DVD-Ausstattung / Bonusmaterial: - Kinotrailer - Kapitel- / Szenenanwahl - Audiokommentar des Regisseurs Ron Howard - Audiokommentar des Drehbuchautors Akiva Goldsman - Unveröffentlichte Szenen (Regie-Audiokommentar optional) - A Beautiful Partnership: Ron Howard und Brian Grazer - Entwicklung des Drehbuchs - Treffen mit John Nash - Verleihung des Nobelpreises für Wirtschaft an John Nash - Casting Russel Crowe und Jennifer Connelly - Darstellung des Alterungsprozesses im Film - Vom Storyboard zum Film - Spezialeffekte - Die Musik zum Film - Hinter den Kulissen - Oscar-Verleihung
Das amerikanische Kino vor den Oscar-Nominierungen: Neue Filme von Robert Altman, Ron Howard, Ridley Scott und anderen
NEW YORK, im Januar
Nur in New York kann man monatelang regelmäßig ins Kino gehen und dennoch jenen formelhaften Filmen ausweichen, in denen "weiße Männer mittleren Alters (oder solche, die ihre Werte teilen) zur Unterhaltung zwölf- bis neunzehnjähriger Jungs Dinge in die Luft sprengen", wie es ein amerikanischer Kritiker formulierte. Es sind die Filme, von denen Hollywood lebt. Etwa Mitte Dezember aber, unmittelbar vor Ablauf der Bewerbungsfrist am Jahresende für all die Preise, die zwischen Januar und März zu vergeben sind, ändert sich das.
Für kurze Zeit macht sich überall im Land eine Vielfalt auf den Leinwänden breit, die jedes Jahr von neuem überrascht. Eine Welle anspruchsvoller Mainstream-Filme schwappt aus den Studios in die Kinos; dazu kommen kleinere Filme von einst unabhängigen Firmen wie Miramax (Disney) oder USA Films (Vivendi), die sich auf Festivals oder durch Mundpropaganda einen so guten Ruf erworben haben, daß ihnen ebenfalls Preischancen eingeräumt werden. Während das ganze Jahr über gilt, daß jenseits von New York jene Teile des Publikums, die nicht Teenager und auch nicht männlich sind, vor dem Fernseher besser als im Kino aufgehoben sind, finden sie jetzt auch dort Geschichten für den gehobenen Geschmack, Geschichten mit Figuren, die einen Namen haben, den man sich merken kann, mit Problemen, an denen teilzuhaben sich lohnt, und mit Darstellern, die mehr tun, als in friedlichen Augenblicken ihre Stuntmen zu vertreten.
Die Bestenlisten der Kritiker und Magazine, die den ersten Preisvergaben vorausgehen, zeigten in diesem Jahr ein Durcheinander, in dem der Lieblingsfilm einiger bei anderen als schlechtester Film des Jahres rangierte ("Moulin Rouge"). Die ersten Kritikerpreise, die Anfang Januar vergeben wurden, bestätigten diese Uneinigkeit. Den New Yorker Kritikern war bereits im Dezember David Lynchs "Mulholland Drive" der beste Film, dem National Board of Review hingegen "Moulin Rouge" von Baz Luhrmann, während die Kritiker in Los Angeles "In the Bedroom" von Todd Fields bevorzugten und das American Film Institute gar den "Herrn der Ringe". Bei den Golden Globes wiederum wurde "A Beautiful Mind" von Ron Howard als bester dramatischer Film ausgezeichnet (F.A.Z. vom 22. Januar). Für die Oscars gibt es bei diesen Vornoten keinerlei sichere Voraussage.
Das Publikum muß sich um solche Listen nicht kümmern. "Moulin Rouge" ist längst aus den Kinos verschwunden, dafür sind "Ali" von Michael Mann oder "Black Hawk Down" von Ridley Scott zu sehen, die von der Kritik zwar wohlwollend vorgestellt, von den Preiskomitees bisher aber weitgehend übersehen wurden, dazu Robert Altmans "Gosford Park" und "The Man Who Knew Too Much", "Iris" "Memento" und "Monster's Ball".
Es sind Filme, die aus Hollywood, und solche, die aus dem Nichts kommen. Sie wirken als Gruppe zwar nicht so aufregend wie etwa jene des Jahres 1971, als "Klute" und "The Last Picture Show", "Carnal Knowledge", "A Clockwork Orange", "McCabe and Mrs. Miller" und "The French Connection" - allesamt Studiofilme - um Preise und Plazierungen auf Bestenlisten konkurrierten. Aber sie sind doch so gut und verschiedenartig, daß sich die Klage über die vollkommene Indifferenz der aktuellen Filme, die beinahe jährlich der Oscar-Verleihung vorausgeht, nicht ernsthaft aufrechterhalten läßt.
Ron Howards "A Beautiful Mind" wäre kein besonderer Film, hätte er nicht Russell Crowe und Jennifer Connelly als Darsteller und als Vorlage ein Leben, das sich in seinem dreiaktigen Verlauf von selbst schon der Hollywoodkonvention beugt. Begänne der Film mit dem geläufigen "Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen ist rein zufällig", hätten wir es mit einem Melodram zu tun, das von einem schizophrenen Mathematiker, seiner treuen Gattin, einer Heilung gegen alle Wahrscheinlichkeit und von der späten Anerkennung dieses zutiefst gestörten Genies erzählt. Da er aber mit der Mitteilung beginnt, es handele sich um eine wahre Geschichte, muß gesagt werden, daß dieser Film eine große Lüge ist.
John Nash, der Mathematiker, um den es geht, ist heute dreiundsiebzig Jahre alt. 1994 bekam er den Nobelpreis der Wirtschaftswissenschaften für eine Theorie, die er als Doktorand in Princeton in den späten vierziger Jahren entwickelt hatte. Schon damals fiel er durch seinen Mangel an sozialen Fähigkeiten auf und zeigte Anflüge geistiger Verwirrung. In den folgenden Jahren lehrte er am M.I.T. und war Mitglied eines think tank des Verteidigungsministeriums, bis seine Wahnvorstellungen sein mathematisches Genie überrollten. Nash verbrachte einen Großteil der kommenden Jahrzehnte in Nervenheilanstalten. Seine Frau ließ sich von ihm scheiden. Irgendwann fiel seine Erkrankung wundersam von ihm ab, und heute, seit einem Jahr wieder verheiratet mit seiner früheren Frau, ist er einer der beliebtesten Narren auf Princetons Campus. So heißt es.
Im Film ist Nash ein anderer. Seine Frau verläßt ihn nie, seiner Krankheit entkommt er durch schiere Willenskraft. "A Beautiful Mind" macht ihn außerdem zu einem überzeugten kalten Krieger, der er niemals war. Auch von seinem ersten Kind mit einer anderen Frau, die er der Armut überließ, erfahren wir nichts, damit wir nur dem liebenswürdigen genialen Irren nicht entfremdet werden, der Nash niemals war. Durch Russell Crowe aber, der diesen weitgehend fiktiven John Nash spielt, erfahren wir etwas anderes.
Wir sehen zum Beispiel, daß Geistesgestörte, anders als Dustin Hoffman etwa es vormachte, auch ohne die große Geste schauspielerischer Angeberei gespielt werden können. In Crowes unbeholfener Körperlichkeit sehen wir, wie Seele, Geist und Körper sich voneinander entfernen oder in den wenigen glücklichen Momenten in eins fallen; wir sehen auch, daß es fast unmöglich ist, sich in der äußeren Welt zurechtzufinden, wenn die innere einer ganz anderen Logik folgt. Und Ron Howard, ein Regisseur, der nicht für große Wagnisse bekannt ist und hier so unverschämt die Unwahrheit sagt, zeigt uns doch auch die im Innern verschlossene Welt, in der Nash wohnt, und die ungeheuerliche Wirklichkeitsmacht seiner Wahnvorstellungen. Howard inszeniert sie ohne Schleier oder andere visuelle Tricks gerade so, als seien sie Teil der realen Welt, so wie sie es für Nash immer waren. So gelingt es ihm und Russell Crowe, in den Grenzen dieses bereinigten Lebenslaufs etwas zu zeigen, das mit Wahrheit zu tun hat.
Die Gruppe der unabhängig produzierten, kleineren Filme, die mit den Studioproduktionen nur um Preise, nicht um Kasseneinnahmen konkurrieren können, vertritt mit "Gosford Park" Robert Altman. Sein Ensemble vor allem britischer Darsteller ist großartig und so umfangreich, daß ein guter Teil des Films vergangen ist, bevor die Familien- und sonstigen Verhältnisse klar- werden. Eine Gruppe englischer Adliger trifft sich, von ihren Bediensteten begleitet, zur Fasanenjagd auf einem Landsitz. Zwei Amerikaner, Filmleute, sind ebenfalls eingeladen. Es ist das Jahr 1932, und irgendwann geschieht ein Mord. Altman teilt die Welt in oben und unten, wobei die meisten Stars der Besetzungsliste unter den Bediensteten und also unten in der Marmeladenküche zu finden sind. Die vielen Figuren und Nebenhandlungen sind so meisterhaft ineinander verwoben, das Dekor so voller Überfluß und die Dialoge so versnobt, daß "Gosford Park" ein kleines folgenloses Meisterstück geworden ist, das vor allem Maggie Smith und Helen Mirren die Rollen gibt, nach denen sich Damen eines gewissen Alters so häufig unerfüllt sehnen.
Über die Jahrzehnte hat sich bewiesen, daß ein Oscar-Film nicht nur herausragende Einspielergebnisse vorweisen muß, sondern auch freundliche, besser noch enthusiastische Kritiken und eine erfolgreiche Laufzeit, in der auch das Publikum seiner Zustimmung Ausdruck gibt. Vielleicht, weil er an der Kasse so überaus erfolgreich ist, vielleicht aber auch, weil er technisch makellos aussieht, scheint "Black Hawk Down" von Ridley Scott (F.A.Z. vom 3. Januar) vom Oscar-Wettbewerb daher noch keineswegs disqualifiziert. Der Film über einen desaströsen Einsatz amerikanischer Soldaten in Somalia im Jahr 1993 ist eine Zweieinhalbstundenfassung der ersten zwanzig Minuten von Spielbergs "Saving Private Ryan" und könnte wie ein dokumentarisches Kriegsspektakel wirken, wüßte man nicht, daß die erschöpfenden Kämpfe unter Schweiß und Blut in Hitze und Dreck nicht einmal gespielt, sondern digital simuliert wurden. Inzwischen hat der Film jenseits aller Kontrolle Hollywoods mittels einer Raubkopie vor zweihundert Männern in Mogadiscio seine Premiere am Ort des Geschehens erlebt. Der Kriegsherr Osman Ali Otto, der von Scott wenig vorteilhaft gezeichnet wurde, hat bereits rechtliche Schritte angekündigt.
Alle Filme übrigens, die jetzt in den amerikanischen Kinos zu sehen sind, wurden vor den Terroranschlägen des 11. September entwickelt und gedreht. Die meisten hatten auch den Schneideraum bereits verlassen, als das World Trade Center fiel.
VERENA LUEKEN
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

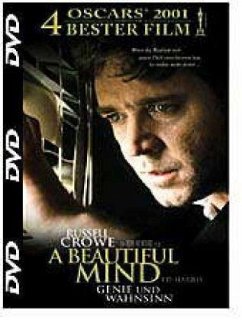
 FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG
FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG