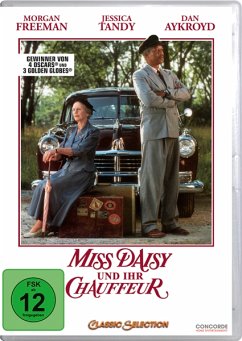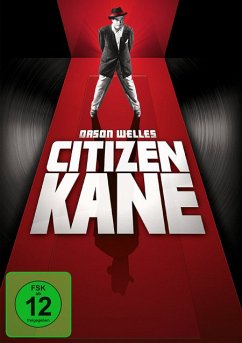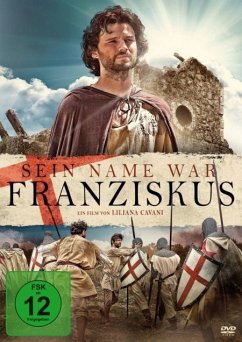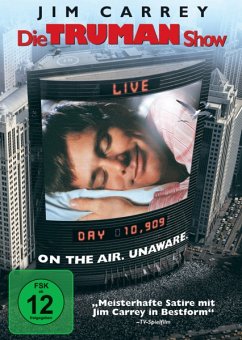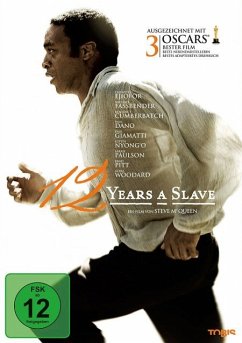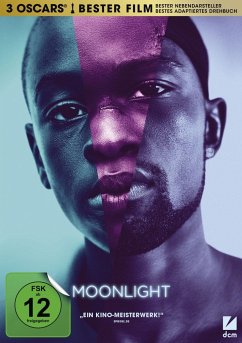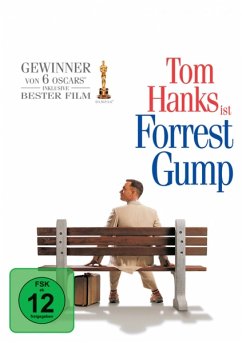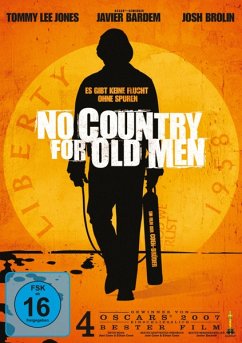A Beautiful Mind - Genie und Wahnsinn
A Beautiful Mind
Regie: Howard, Ron;Besetzung: Crowe, Russell; Connelly, Jennifer; Harris, Ed
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
7,99 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
4 °P sammeln!
Faszinierendes Biopic über das schizophrene Mathegenie John Nash, dessen Frau über Jahrzehnte seiner Krankheit zu ihm hält.
Dank eines Stipendiums kommt John Forbes Nash Jr. 1947 an die amerikanische Eliteuniversität Princeton, um höhere Mathematik zu studieren. Es fällt Nash jedoch nicht leicht, sich in Princeton zurechtzufinden: gesellschaftlicher Smalltalk und oberflächliche Nettigkeiten findet er überflüssig, und auch für die Vorlesungen interessiert der Einzelgänger sich herzlich wenig. Er ist von einer einzigen Idee besessen: eine völlig originäre Theorie zu entwickeln. Denn er ist davon überzeugt, dies sei die einzige Möglichkeit für ihn, jemals etwas Bedeutsames zu bewirken. Kurz bevor sein Doktorvater jede Hoffnung für den talentierten jungen Mann aufgibt, gelingt Nash mit einer Forschungsarbeit zum Thema "Spiel- und Entscheidungstheorie" über die mathematischen Prinzipien des Wettbewerbs der Durchbruch, mit dem keiner mehr gerechnet hätte.
Dabei steht seine Arbeit im kühnen Widerspruch zur Doktrin von Adam Smith, dem Vater der modernen Wirtschaftswissenschaften. Dieser geniale Coup sichert Nash einen heiß begehrten Posten als Forscher und Dozent am MIT (Massachusetts Institute of Technology), doch ganz zufrieden ist Nash immer noch nicht. Als ihn wenig später der zwielichtige William Parcher im Namen des Pentagon als geheimen Code-Dechiffrierer anwerben will, sagt Nash sofort zu. Er genießt die neue Herausforderung, endlich kann er sein außerordentliches Talent auf die Probe stellen. Fieberhaft durchforstet er fortan die Zeitungen nach geheimen Botschaften der Russen. Seine Ergebnisse steckt er in einen Umschlag, den er nachts in den Briefkasten einer abgelegenen Villa wirft. Neben seiner Geheim-Mission lehrt Nash weiter am MIT. In einer seiner Vorlesung lernt er die schöne und hochbegabte Physikstudentin Alicia kennen und verliebt sich in sie. Was erstaunlicher ist: sie verliebt sich ebenfalls in den verschlossenen, merkwürdigen und hochbegabten Mathematiker, und schon bald heiraten die beiden.
Doch das Geheimnis, das Parcher und die Dechiffrierungen betrifft, kann er nicht einmal mit seiner Frau teilen. Immer mehr steigert Nash sich in die Heimlichtuerei und bald schon weiß er nicht mehr, wem er vertrauen kann. Die ständige Gefahr fordert ihren Preis: Nash ist verschlossen, obsessiv und schließlich völlig verloren in einer anderen Welt - Halluzinationen begleiten ihn auf Schritt und Tritt. Unfähig, zwischen Phantasie und Realität zu unterscheiden, steigert er sich immer mehr in seinen Verfolgungswahn. Gibt es Parcher wirklich? Wer sind die Russen, die ihn verfolgen? Und ist der Arzt, der "Paranoide Schizophrenie" bei Nash diagnostiziert, ein Doppelagent?
Dabei steht seine Arbeit im kühnen Widerspruch zur Doktrin von Adam Smith, dem Vater der modernen Wirtschaftswissenschaften. Dieser geniale Coup sichert Nash einen heiß begehrten Posten als Forscher und Dozent am MIT (Massachusetts Institute of Technology), doch ganz zufrieden ist Nash immer noch nicht. Als ihn wenig später der zwielichtige William Parcher im Namen des Pentagon als geheimen Code-Dechiffrierer anwerben will, sagt Nash sofort zu. Er genießt die neue Herausforderung, endlich kann er sein außerordentliches Talent auf die Probe stellen. Fieberhaft durchforstet er fortan die Zeitungen nach geheimen Botschaften der Russen. Seine Ergebnisse steckt er in einen Umschlag, den er nachts in den Briefkasten einer abgelegenen Villa wirft. Neben seiner Geheim-Mission lehrt Nash weiter am MIT. In einer seiner Vorlesung lernt er die schöne und hochbegabte Physikstudentin Alicia kennen und verliebt sich in sie. Was erstaunlicher ist: sie verliebt sich ebenfalls in den verschlossenen, merkwürdigen und hochbegabten Mathematiker, und schon bald heiraten die beiden.
Doch das Geheimnis, das Parcher und die Dechiffrierungen betrifft, kann er nicht einmal mit seiner Frau teilen. Immer mehr steigert Nash sich in die Heimlichtuerei und bald schon weiß er nicht mehr, wem er vertrauen kann. Die ständige Gefahr fordert ihren Preis: Nash ist verschlossen, obsessiv und schließlich völlig verloren in einer anderen Welt - Halluzinationen begleiten ihn auf Schritt und Tritt. Unfähig, zwischen Phantasie und Realität zu unterscheiden, steigert er sich immer mehr in seinen Verfolgungswahn. Gibt es Parcher wirklich? Wer sind die Russen, die ihn verfolgen? Und ist der Arzt, der "Paranoide Schizophrenie" bei Nash diagnostiziert, ein Doppelagent?

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.