Es ist die Geschichte der jungen talentierten Schauspielerin Vicki Lester und des alkoholkranken Filmstars Norman Maine. Vicki Lester kellnert, wie so viele Schauspieler, auf einer Hollywoodparty, wo sie den alkoholisierten Norman Maine kennenlernt. Norman verliebt sich in sie und erkennt vor allem ihr Talent. Er führt sie in die Filmwelt Hollywoods ein. Sie steigt daraufhin zu einem neuen Star auf. Die beiden heiraten. Während Vicki von Erfolg zu Erfolg eilt, zieht es Norman Maine immer tiefer in die Strudel des Alkohols.
Bonusmaterial
Artworkgalerie
Ein netter Schauspieler und eine exaltierte Sängerin trauen sich an ein Kronjuwel der Hollywoodgeschichte - und Bradley Coopers "A Star Is Born" wird für ihn und Lady Gaga zum doppelten Karrieregipfel.
Als die Riesenmenschenmenge ihr endlich zuhört, legt sie sich die Hände auf die Augen, weil ihr der Moment zu groß ist. Aber dabei singt sie weiter, bald stärker denn je. Vor diesem Durchbruch will sie ihre eigenen Lieder lange nicht singen, schmettert lieber "La vie en rose", bewundert und geliebt von Drag Queens und anderen eigensinnigen Herzen. Der Mann, der sie entdeckt, singt ihr bald eins der Lieder vor, die sie geschrieben hat. Da versteht sie: Das ist gut und muss gesungen werden, warum also nicht von ihr selbst? Bradley Coopers Film "A Star is Born" ist eine zeitgemäße Liebesgeschichte: Die Frau prügelt sich für den Mann, der küsst dafür ihre verletzten Knöchel. "Sie sind ein Gentleman", sagt sie, ist sich aber nicht ganz sicher, setzt daher hinzu: "I think."
Es gibt schon drei Filme, die so heißen wie dieser und vom selben Stoff handeln. Den ersten hat William A. Wellman 1937 geschaffen, nach einem Drehbuch, in dem unter anderen die große Dorothy Parker ihre Finger hat knacken lassen. Der zweite stammt von George Cukor und aus dem Jahr 1954; die Hauptrollen spielten damals Judy Garland und James Mason. 1976 inszenierte Frank Pierson die dritte Version, diesmal mit Barbra Streisand und Kris Kristofferson. In der Fassung von Bradley Cooper, die diese Woche in die deutschen Kinos kommt, spielt der Regisseur den Kerl, und die Frau spielt Stefani Joanne Angelina Germanotta, fürs Volk: Lady Gaga.
Die Unterschiede zwischen den Leading Ladies Garland, Streisand und Gaga sehen Blinde und hören Taube. Subtiler dagegen machen sich die zwischen den drei Männern geltend: Alle drei verkörpern Trinker auf dem absteigenden Ast, aber während man bei Mason das Gefühl hat, er werde von etwas Bösem durch den Film getrieben, das nur unterschwellig auch noch etwas Trauriges ist, verhält sich's bei Cooper genau umgekehrt, wohingegen Kristofferson weder dämonisch noch gequält wirkt, sondern nur müde (es waren halt die Siebziger; so ein langes Gitarrensolo schlaucht schon schwer). Noch interessanter kontrastieren die drei Paardynamiken - keine Privatangelegenheiten, sondern Bühnengeschehen, öffentlich wie der destruktive Klatsch in unserem Social-Media-Zeitalter: Mason torkelt in Garlands Show, sie muss ihn zähmen und managen; Kristofferson dagegen lockt Streisand mit seinem offenen Hemd ins Rampenlicht (man wünscht sich beim Zuschauen vierzig Jahre danach, peinlich berührt, die Leute hätten sich damals ein bisschen ordentlicher angezogen - sexuelle Liberalisierung ohne raffinierte Umgangsformen ist barbarisch). Bradley Cooper wiederum guckt seine Erwählte an, wie das nur Liebe kann, staunend vor Begeisterung darüber, dass er seine Charakterbaustelle dank ihrem Anblick wenigstens ein paar Minuten lang vergessen darf. Sie guckt zurück, als traue sie seinem Bart nicht, seinem Herzen aber ohne Vorbehalt. Die Chemie oder Elektrizität oder wie man den heiligen Hokuspokus sonst nennen soll, ohne den Liebe nicht leben kann, taucht diesen Film in Farben, die glaubhaft machen, dass hier zwei erwachsene Menschen überhaupt zum ersten Mal lieben, obwohl sie als Figuren ja Echos aus anderen Filmen sind, also das Gegenteil von "zum ersten mal", im Fall des Mannes sogar verschärft zum Maximum des Erwachsenseins, das einem Country-Rock-Helden zusteht: Totalkaputtheit. Das Paradox einer ersten Liebe unter Nichtkindern, Erfahrenen und Illusionslosen verwirklicht sich als Regiedebüt, das wie das Gipfelwerk eines alten Hasen wirkt - als Remake, das kein Vorbild braucht. Passt alles: Die Kunstepoche "Pop" wusste schon in der Wiege, was "Retro" bedeutet, und hat sofort angefangen, davon zu erzählen.
Coopers "A Star Is Born" kennt erfreulicherweise mehr als eine Sorte Liebe, zum Beispiel die bis zum Gewaltakt leidenschaftliche Beziehung zweier Brüder, die der Verlust des Vaters in früher Jugend auf Verhaltensmuster festgenagelt hat, denen sie nie mehr entkommen werden (der große Sam Elliot, der seit seinem ersten Erscheinen 1969 in "Butch Cassidy and the Sundance Kid" zahllose Hollywoodfilme uneitel veredelt hat, liefert als Coopers Bruder eine seiner vielen feinfühligen Altersbravourleistungen ab).
Psychologisch differenzierte Arbeit leistet der Regisseur auch als Schauspieler: Seine Angst um die Geliebte zittert wie Herbstlaub am dürren Zweig; er sieht korrekt voraus, dass der Ruhm sie zwingen wird, ihre empfindlichste Wahrheit der ganzen Welt preiszugeben. Cooper nimmt, wo es um dieses Thema geht, die Bedrohlichkeit der Menschenverwertung durch die Unterhaltungsbranche ganz in sein Spiel und in seine Musik: "Maybe it's time to let the old ways die", singt er, und diese "old ways" sind nicht irgendein Ahnenerbe, sondern die Machenschaften der Kulturindustrie, bei der sich die 1954er-Fassung von "A Star Is Born" im Vorspann demütig bedankt, weil sie ein paar Requisiten (den Oscar zum Beispiel) nutzen darf.
Dies zur Regie und zu den Männerschmerzen. Der springende Punkt an "A Star Is Born" ist freilich letztlich der Star, der hier (wieder)geboren wird. Peinliche Enthüllung: Bis 2015 hielt der Rezensent Lady Gaga für eine nicht besonders inspirierte Reprise mittelintelligenter Popstarmodelle aus dem letzten Jahrhundert. Dann betrat sie die Fernsehserie "American Horror Story" wie ein römischer Kaiser das Colosseum, nein: rauschte in ihre Eröffnungsszene wie trunkenes Blut in heiße Ohren, schwebte und schritt, metzelte und wälzte sich durch mehrere Takte der Songkreissäge "Tear you Apart" von She Wants Revenge und riss damit anstrengungslos eine Show an sich, in der immerhin Gigantinnen wie Angela Bassett und Kathy Bates das Hausrecht ausüben. Ein winziger Zweifel blieb, so unwiderstehlich dieses Phänomen mit den gebleichten Blicken und fischmenschlichen Bewegungen aussah: Hatte sich die Frau nicht einfach als teils anziehende, teils abstoßende Kunstfigur selbst gecastet und spielte diese Figur jetzt einfach immer und überall, egal, wie die Rolle hieß (die Älteren kennen das Konzept unterm Namen "Klaus Kinski")? Wie blöd man manchmal ist. Lady Gaga kann spielen, singen, alles. Wer's bei "A Star Is Born" nicht merkt, hat ein Rad ab.
In einem dummen Text, den ein kluger Mann vor dreißig Jahren schrieb, beschwerte sich der kluge Mann darüber, dass Prince ja nur ein schwacher Abklatsch von Jimi Hendrix sei und Madonna eine billige Kopie von Marilyn Monroe. Der Dichter Ezra Pound fand, jede Zeit müsse sich von den Kunstschöpfungen, welche die Zeit überdauern, ihre eigenen Versionen erarbeiten. Aber um Überdauern geht es nicht mehr, wenn die Reichweite der Medien weltweit ist, wenn immer mehr Speicher voll sind und immer mehr Nachrichten menschlich ekelhaft.
Es geht um das Recht des Unwiederbringlichen, das Leben zu erleuchten. "Weil ich vor dir nie geliebt habe, werde ich nach dir nie mehr lieben können", sagt das Lied, das in "A Star Is Born" übrig bleibt, wenn alles andere verbrannt ist.
Liebesglück ist eine Kunstmetapher für jenes seltene Selbstbewusstsein der Sterblichkeit, das ihr dämmert, wenn sie begreift, dass Schönheit nicht ewig sein muss, um übers Diesseits und seine elenden Kleinlichkeiten zu siegen. "A Star is Born" von Bradley Cooper sagt und singt davon - eins der raren Märchen, die nicht lügen.
DIETMAR DATH
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

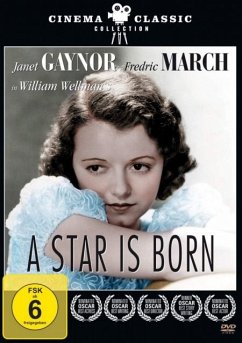


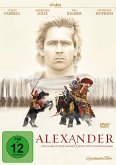


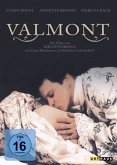

 FSK: Freigegeben ab 6 Jahren gemäß §14 JuSchG
FSK: Freigegeben ab 6 Jahren gemäß §14 JuSchG