"Mein Name ist Lester Burnham. In weniger als einer Woche werde ich tot sein. Aber das weiss ich natürlich noch nicht..." Lester Burnham (Kevin Spacey) ist der Anti-Held des Jahres, eine jämmerliche Spießerseele, die irgendwann alles hinschmeißt und einen zweiten Anlauf ins Leben wagt. Seine Familie nimmt ihm das ausgesprochen übel - das Kinopublikum aber war begeistert! "American Beauty" erwies sich als der Überraschungshit des Jahres, war mit fünf Academy Awards (u.a. Bester Film, bestes Drehbuch, bester Hauptdarsteller) der große Abräumer bei der Oscar-Verleihung 2000, wurde zudem mit drei Golden Globes und dermaßen vielen anderen Preisen ausgezeichnet, dass selbst Regisseur Sam Mendes inzwischen den Überblick verloren haben dürfte. Es ist die ultimative Satire auf den amerikanischen Traum, ein bitterböser Blick hinter die geschniegelten Kulissen der Vorstädte. Nicht nur Lester Burnham - der seinen Job hasst, der heimliche erotische Phantasien über die minderjährige Freundin seiner Tochter hegt, der nicht mehr weiss, was er noch mit seiner Ehefrau reden soll - ist hier unglücklich. Seine Gattin Carolyn (Annette Bening), deren Drang zum Perfektionsimus bereits an eine Manie grenzt - ist scharf auf ihren größten Geschäftskonkurrenten. Lesters Tochter Jane (Thora Birch) verachtet ihre Eltern und liebt den psychisch labilen Nachbarsjungen Ricky (Wes Bentley). Der dealt allerdings mit Drogen, muss sich nahezu täglich der brutalen Mißhandlungen seines Vaters (Chris Cooper) erwehren und mitansehen, wie seine Mutter im Medikamentenrausch dahindämmert.
Bonusmaterial
- Kinotrailer - Kapitel- / Szenenanwahl - Animiertes DVD-Menü - Original-Audio-Kommentar mit Regisseur Sam Mendes und Drehbuchautor Alan Ball - Booklet: 4-seitig - Hinter den Kulissen - Kurzfeature - Storyboard Präsentation
Fünf Oscars für "American Beauty": Ein Film versöhnt die Wirklichkeit mit der Kunst
Alles war voraussehbar an diesem Wochenende. Es war abzusehen, dass Wladimir Putin zum Präsidenten gewählt würde, es lag auf der Hand, dass "American Beauty" haufenweise Oscars abräumen würde. Man ahnte, dass sich selbst das Wetter an die Voraussagen halten würde. Alles war erwartbar wie das Leben in einer amerikanischen Vorstadt, in der jeder weiß, dass es ein Leben nach dem Tode gibt, weil hier auch weiterlebt, wer längst tot ist. Alles war absehbar und ist gekommen wie erwartet, man nimmt es wie den Regen oder das schöne Wetter, spannt den Schirm auf oder legt den Mantel ab. Und trotzdem liegt ein Hauch von Wunder über dem Erfolg von "American Beauty". Man fasst es kaum.
Man fasst es nicht, dass so ein Film gelingen und sich nicht nur im kunstseligen, verschnörkelten Europa, sondern auch im smarten, ironieresistenten Hollywood behaupten konnte. Man glaubt es nicht, dass ein Film mit bescheidenem Budget, wenigen Akteuren und Schauplätzen, ohne Action und Stunts so viel Bewegung hervorrufen konnte. Man begreift nicht, wie ein englischer Regisseur und ein debütierender Drehbuchschreiber einen Film drehen können, in dem sich Amerika verzückt, verwirrt, erschreckt erkennt: Man ahnte nicht, dass ein kleiner Film so groß sein kann.
Aber auch Hollywood, Amerika sind wie die Welt und wollen betrogen sein, und das hat Sam Mendes, der Regisseur, getan. Amerika, so weiß jedes Schulkind, will die Wirklichkeit, nichts als die Wirklichkeit, und diese Wirklichkeit hat, so scheint es, Sam Mendes ihm gegeben, während er in Wahrheit dem Publikum das süße Gift der Kunst einflößte. Die Kunst ist eine schöne Lüge und die Wirklichkeit nur eine hässliche: "American Beauty" ist nicht ein Film über die triste Realität der Vorstadt und die midlife crisis von Männern und Frauen, sondern ein grandioses Werk manieristischer Bühnenkunst und Malerei, ein Film aus einer Welt, die an das Mittelalter erinnert, als es in seine endlife crisis trat. Auch da roch es nach Rosen und nach Blut.
Natürlich hat Hollywood Recht gehabt: Dies ist ein Film über Amerika, genauer und wirklicher als so viele wirklich amerikanische Filme, ein Kunstwerk, wie es nur im Blick dessen entsteht, der von sehr weit außen kommt. In den Fünfzigern hat Vladimir Nabokov dieses Amerika beschrieben, in "Pnin" und in "Lolita" - Erzählungen über Verirrte in einem Land, das die Schönheit anbetet und dem sie so selten gelingt.
"American Beauty" verrät das Leben nicht an die Kunst und die Kunst nicht an das Leben. Der Film, der sich auf die Suche nach der Schönheit wie nach einem Gral macht, begibt sich auf einen schwierigen Grenzweg zwischen Komödie und Tragödie, zwischen dem Gelächter und den Tränen, ein Grenzgang, den nur wenige beherrschten, unter ihnen John Cassavetes. Wer diesen Weg geht, kann nicht sicher sein, an seinem Ende das Erhabene zu finden. Sicher ist nur, dass das Leben meistens dumm ist und immer tödlich endet und dass die Schönheit leicht ist und dabei so schwer zu greifen wie eine in der Luft flatternde Plastiktüte, die niemand festhalten kann, weil sie nichts ist als ein Bild, nichts als ein Film.
"American Beauty" ist ein literarischer, ein poetischer Film. Sam Mendes, der vom Theater her kommt, hat seinen Figuren ein Maß an Entwicklung erlaubt, für das nur wenige Filme heute die Geduld aufbringen. Mit Ausnahme der bis zur Katatonie schwermütigen Mutter ist am Ende niemand mehr, was er vorher war. Sie alle haben eine schwere Aufgabe, sie müssen sich noch einmal selbst zur Welt bringen. Die Alten tun es, weil sie es nicht anders gelernt haben, als lächerliche Rebellen, die Jungen, weil sie es nicht anders können, als hilflose Heilige. Am beeindruckendsten tut es der junge Ricky, ein verjüngter Anthony Perkins, ein wieder geborener Buster Keaton, der wie ein schweigsamer Landpfarrer statt des Breviers eine Videokamera hält. Er filmt die Erscheinungen des Heiligen, flatternde Papiertüten, nackte Brüste und andere Epiphanien. Er ist der stoische Hüter der schönen Lüge.
ULRICH RAULFF
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

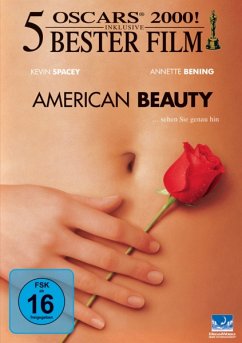






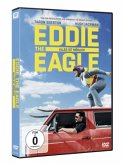
 FSK: Freigegeben ab 16 Jahren gemäß §14 JuSchG
FSK: Freigegeben ab 16 Jahren gemäß §14 JuSchG