Brahim ist dreißig, Muslim und schwul. In der Familie ist seine Sexualität immer noch ein Tabuthema, das für Spannungen sorgt - und als selbst die große Geburtstagsfeier seiner Mutter in eine Konfrontation mit den konservativen Traditionen seiner Verwandtschaft mündet, flüchtet sich der junge Belgier ins nächtliche Treiben Gleichgesinnter.
Dort wähnt er sich geschützt, doch sein Eingreifen in einen Streit bringt die Begegnung mit einer Gruppe angetrunkener junger Männer und führt zur verhängnisvollsten Entscheidung seines Lebens: Brahim steigt in ihr Auto und wird zur Zielscheibe höhnischer Witze, die zunächst zu erniedrigenden Handgreiflichkeiten und bald darauf zu einer letzten Reise im Kofferraum des Wagens führen.
Auf einem Feld außerhalb der Stadt endet die Fahrt, doch für Brahim ist das erst der Beginn einer grausamen Tortur, in deren Verlauf der letzte Rest an Menschlichkeit in seinen Peinigern verloren geht.
Dort wähnt er sich geschützt, doch sein Eingreifen in einen Streit bringt die Begegnung mit einer Gruppe angetrunkener junger Männer und führt zur verhängnisvollsten Entscheidung seines Lebens: Brahim steigt in ihr Auto und wird zur Zielscheibe höhnischer Witze, die zunächst zu erniedrigenden Handgreiflichkeiten und bald darauf zu einer letzten Reise im Kofferraum des Wagens führen.
Auf einem Feld außerhalb der Stadt endet die Fahrt, doch für Brahim ist das erst der Beginn einer grausamen Tortur, in deren Verlauf der letzte Rest an Menschlichkeit in seinen Peinigern verloren geht.
Bonusmaterial
inkl. 24-seitigem Mediabook Interviews mit Regisseur und Kameramann deutscher und OV-Trailer Bildergalerie
Bei Maximilian
Erlenwein geht es in die Tiefe, Aylin Tezel sucht die
Liebe unter
Thirtysomethings, Rodrigo Sorogoyen zeigt ländliche Gewalt in Galicien.
Genrekino hat es schwer in Deutschland - vor allem wenn es aus Deutschland kommt. Den Polizei- und Kriminalfilm hat das Fernsehen derart heruntergewirtschaftet, dass er sich davon kaum noch erholen wird. Science Fiction und Horror sind praktisch nicht existent. Das ist bedauerlich, weil gerade das Ausfüllen einer Form, das Erzählen nach ein paar bewährten Regeln oft die Basis für Größeres gewesen ist.
Die Kölner Augenschein Filmproduktion will sich damit nicht abfinden. Unter den rund 30 internationalen Filmen, die sie seit 2008 produziert hat, finden sich immer wieder ambitionierte Genrefilme. Und es passt, dass man nun mit Maximilian Erlenwein zusammenarbeitet, der in "Stereo" (2014) und "Schwerkraft" (2010) oder der Netflix-Serie "Skylines" (2019) gezeigt hat, wie man einen guten Thriller macht.
Auch "The Dive" ist nicht von Autorengeltungsdrang getrieben, sondern orientiert sich an Kriterien wie Kompaktheit, Handwerk und gut dosierter Action. Es ist ein Remake des Films "Breaking Surface" (2020), dessen Regisseur Joachim Hedén auch am Drehbuch beteiligt war. Statt ins eisige Nordmeerwasser geht es ins angenehmere Mittelmeer vor Malta. Zwei Schwestern treffen sich zu ihrem jährlichen Tauchausflug. Nach einem Erdrutsch sitzt May in 28 Metern Tiefe fest. Drew, die jüngere, muss sie retten.
Erlenwein verzichtet dabei auf Haie und andere externe Gefahren. Er spart sich auch eine aufwendige psychologische Innenausstattung der Schwestern. Es gibt ein paar knappe Rückblenden in die Kindheit, May und Drew mit ihrem Vater, der sie zum Tauchen brachte. Auf der Fahrt zum Strand sind zwischen beiden kleine Spannungen spürbar. Mehr nicht. Die Dialoge sind unter Wasser naturgemäß auf das Nötigste beschränkt. Erlenwein übertreibt es auch nicht mit den Hindernissen, die eine Rettung verzögern oder immer unwahrscheinlicher machen. Drew muss kämpfen und leiden, aber sie findet Lösungen.
Für die beiden Schauspielerinnen sind das nicht gerade dankbare Rollen. Das Gesicht von Louisa Krause als May ist praktisch nur anfangs ohne Maske zu sehen, Sophia Lowe als Drew hat immerhin noch ein paar Szenen an Land, weil sie mehrfach auftauchen muss, um Sauerstoffflaschen zu holen.
"The Dive" bleibt im Rahmen dieser Konstellation, er versucht nicht, auszubrechen durch Überhöhung. Er begnügt sich mit dem Erwartbaren, und das macht er handwerklich makellos. Wirklich begeistern kann er einen allerdings nicht, weil die Action, die physischen Operationen zur Rettung, zwar für eine permanente Grundspannung sorgen, aber die beiden Protagonistinnen einem dabei sehr fern bleiben. Im Grunde arbeitet der Film wie ein professioneller Rettungstaucher, der einfach seinen Job macht, ohne Drama und viel Aufhebens, mit Effizienz und Verlässlichkeit. Da wäre, wenn man sich Erlenweins bisherige Filme ansieht, mehr möglich gewesen. Wer plant, im Sommer einen Tauchkurs zu absolvieren, wird nach dem Film darüber vielleicht noch mal nachdenken. Aber das kann man "The Dive" nun wirklich nicht anlasten.
***
Aylin Tezel verdient mehr als nur Respekt für ihr Debüt. Sie hat das Drehbuch geschrieben, sie hat Regie geführt, die Hauptrolle gespielt, in England gedreht und auf Englisch. Sie hat alles hineingelegt in "Falling Into Place", um einen Kinofilm daraus zu machen. Sie hat sich damit auch deutlich vom Dortmunder "Tatort"-Team emanzipiert, dem sie zwischen 2012 und 2019 angehörte.
"Falling Into Place" ist die Geschichte von Kira und Ian. Eine Liebesgeschichte unter Thirtysomethings, ohne dass diese auf ein typisches Generationenporträt zielte. Der Film hat seine starken Momente in der ersten halben Stunde, wenn sich die beiden auf der Isle of Skye vor der schottischen Nordwestküste begegnen. Kira hat sich von ihrem Freund getrennt und sucht Abstand; Ian besucht seine Eltern und drückt sich um die Begegnung mit seiner suizidalen Schwester. Trotz aller Seelenschwere hat die Inszenierung etwas Leichtes, beide probieren etwas aus, flirten, ziehen sich zurück, reden, albern herum, landen in Kiras Pension, sie lassen sich treiben, und diese Stimmung prägt den Film. Am nächsten Morgen dann ist Ian fort. Ohne Nachricht.
In London, wo beide leben, ohne dass sie es voneinander wissen, wird die Konstruktion schematischer. Die Probleme müssen ordentlich abgearbeitet werden. Es gibt zu viele Standardsituationen, die nach Drehbuchwerkstatt aussehen und eine gewisse Schwere erzeugen. Kira hadert mit der Trennung, sie sucht ihren Exfreund auf, der eine neue Freundin hat. Als sie fragt, wie sie denn für ihn sein solle, sagt er nur, sie habe sich schließlich getrennt, und empfiehlt ihr, einen Therapeuten aufzusuchen. Ian stellt sich mit seiner Freundin, bei der er wohnt, nicht viel besser an. Als Musiker erfolglos, ist er gereizt und sagt im Streit zu ihr: "Ich versuche nur, der zu sein, der ich bin." Wenn's hilft . . .
Aylin Tezel und vor allem Chris Fulton als Ian tragen einen durch ihr nuanciertes, intensives Spiel zwar über solche Situationen hinweg, aber einigen dramatischen Wendungen und Plotwindungen haben sie auch nichts entgegenzusetzen. Dass beide sich teilweise blöd anstellen müssen, wäre nicht weiter schlimm, unser aller Leben ist ja voller blöder, erratischer Handlungen. Der Film müsste nur, wenn er davon erzählt, eine klarere Haltung haben dazu, ein wenig Ironie würde guttun, eine Brechung, ein wenig Distanz. Stattdessen ist da ein gewisser Hang zu visueller Lyrik, zu viel im Wind flatternde Wäsche auf der Leine, dazu sanft Schwermütiges von der Tonspur.
Es ist seltsam, man möchte den Film mögen, vor allem wegen seiner beiden Hauptdarsteller. Wenn die bloß nicht immer Aufgaben hätten. Er muss das Verhältnis zur Schwester aufarbeiten, auch zu den Eltern. Sie soll ihr Talent als Bühnenbildnerin und Malerin nicht vergeuden. Diese Agenda lässt die anfängliche Leichtigkeit verschwinden. Der Wunsch nach einer Closure, einem sinnhaften Abschluss, ist stärker als der Impuls, die Dinge einfach laufen und manches in der Schwebe zu lassen. Als könnte man das uns Kinozuschauern nicht zumuten, dass etwas nicht aufgeht; als müssten alle losen Fäden am Ende verschnürt werden zu einer hübschen Schleife um die Geschichte.
Aylin Tezel hat viel investiert, und man wünscht ihr, dass sie diese Energie nicht nur behalten, sondern sich hinwegsetzen möge über das, was ihren Film in einigen Sequenzen einengt, über die Zehn-Drehbuch-Gebote der mehrfach beteiligten Sendeanstalten. Ein wenig spricht das Zögerliche schon aus dem Titel: "Falling Into Place" heißt, dass etwas sich fügt, zusammenpasst. Das klingt wie ein Programm, das zu erfüllen ist. Dagegen könnte man mit Joan Didion setzen: "Play It As It Lays", spiel mit den Karten, die du auf der Hand hast.
PETER KÖRTE
***
In einem entlegenen Dorf im spanischen Galicien werden alle wesentlichen Dinge in der Kneipe besprochen. Daran hält sich auch Vincent (Denis Ménochet), ein Franzose, der sich mit seiner Frau Olga hier niedergelassen hat. Sie haben einen besonders schönen Blick über die Landschaft, auf ihren abschüssigen Wiesen ziehen sie Gemüse. Zwei Aussteiger, zwei, die der Zivilisation den Rücken kehren möchten. Dass die Gespräche in der Kneipe nicht immer das höchste Niveau haben, dass manchmal ganz schön grob gegiftet wird, dass untergründig immer eine gewisse Gehässigkeit zu spüren ist - geschenkt, das macht einer wie Vincent eben unter Männern aus. Bei seiner massigen Physis kann ihm nicht so schnell jemand etwas, und außerdem sind Xan und Lorenzo, zwei Brüder, die ihn besonders deutlich ihre Abneigung spüren lassen, ohnehin meistens betrunken. Konflikte gibt es überall, das aber ist Europa, man teilt doch ein paar Voraussetzungen. Oder nicht? Der Film "Wie wilde Tiere" deutet schon mit seinem Titel an, dass er eine Geschichte erzählen möchte, in der es um die Grundfesten des Menschlichen geht. Nachbarn liegen einander öfter mal unversöhnlich in den Haaren. Was zwischen Vincent und Xan und Lorenzo aber allmählich eskaliert, geht an die Bruchlinien, die derzeit in verschiedener Form durch viele Gesellschaften verlaufen.
Die zwei Einheimischen, die mit ihrer Mutter leben, sind zwei Zurückgelassene. Sie sind unverheiratet, schon die nächste Kleinstadt ist für sie ein großer Sprung. Vincent lässt keineswegs einen Intellektuellen raushängen, er könnte mit den Einheimischen im Prinzip, er ist auch kein "Anywhere" in einer Welt von "Somewheres", die eigentlich "Nowheres" sind. Wirklich von anderswo sind doch einzig die Kapitalinteressen einer norwegischen Firma, die rund um das Dorf einen Windpark errichten möchte. Die Abfindungen dafür sind ein Hohn, für Xan und Lorenzo aber höchst verlockend. Und plötzlich ist alles ganz konkret auf dem Tisch mit einer Frage, auf die nur eine gemeinsame Antwort zählt.
Rodrigo Sorogoyen sieht den wachsenden Spannungen lange Zeit so zu, dass sich das Publikum fast ein wenig in Sicherheit wiegen könnte. Dann aber passiert etwas Schreckliches. Nun kann sich auch Olga nicht mehr heraushalten. "As bestas" heißt der Film im Spanischen, der deutsche Verleih fügt eine entschärfende Vergleichsformel hinzu, während es auf eine Formulierung hinausläuft, die Émile Zolas Roman und Jean Renoirs Film "Bestie Mensch" zu einem geflügelten Wort machten. Sorogoyen schließt an einen Naturalismus an, der den Blick auf die Gattung tendenziell resignativ machen muss. Die Windräder wirken hier wie Schwungräder eines Vergängnisses, dem niemand wirklich etwas entgegensetzen kann. BERT REBHANDL
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

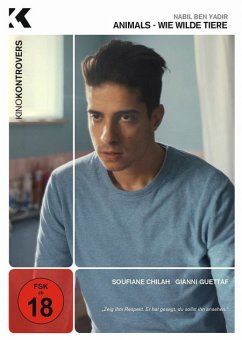









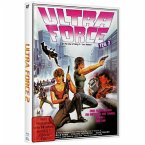







 FSK: Freigegeben ab 18 Jahren gemäß §14 JuSchG
FSK: Freigegeben ab 18 Jahren gemäß §14 JuSchG