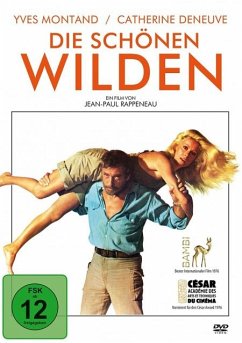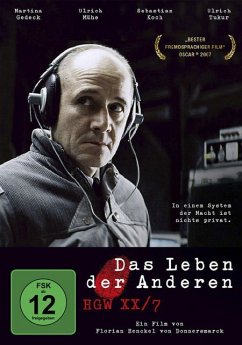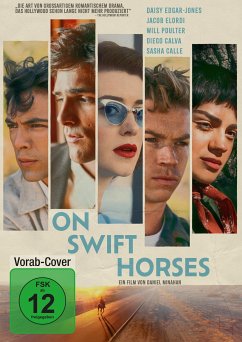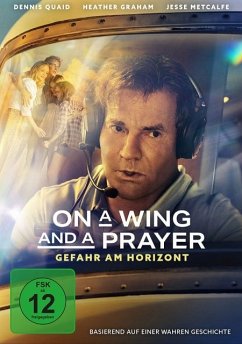Blackbird - Eine Familiengeschichte
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
9,99 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
5 °P sammeln!
Lily (Susan Sarandon) und ihr Mann Paul (Sam Neill) freuen sich auf ein gemeinsames Wochenende mit ihrer Familie in ihrem Landhaus am Meer, ein Ort, der voller glücklicher Momente und Erinnerungen steckt. Ihre beiden Töchter, die angepasste Jennifer (Kate Winslet) und die rebellische Anna (Mia Wasikowska), kommen mit ihren Partnern und Kindern zu Besuch, sowie Lilys beste und älteste Freundin Liz (Lindsay Duncan). Zwischen den ungleichen Schwestern kommt es bald zum Streit. Im Laufe des Wochenendes kommen immer mehr alte Verletzungen, unangenehme Wahrheiten und Geheimnisse ans Licht, die al...
Lily (Susan Sarandon) und ihr Mann Paul (Sam Neill) freuen sich auf ein gemeinsames Wochenende mit ihrer Familie in ihrem Landhaus am Meer, ein Ort, der voller glücklicher Momente und Erinnerungen steckt. Ihre beiden Töchter, die angepasste Jennifer (Kate Winslet) und die rebellische Anna (Mia Wasikowska), kommen mit ihren Partnern und Kindern zu Besuch, sowie Lilys beste und älteste Freundin Liz (Lindsay Duncan). Zwischen den ungleichen Schwestern kommt es bald zum Streit. Im Laufe des Wochenendes kommen immer mehr alte Verletzungen, unangenehme Wahrheiten und Geheimnisse ans Licht, die alle Anwesenden schicksalshaft miteinander verbinden. Am Ende muss sich zeigen, ob sie es schaffen, als Familie wieder zusammen zu finden, um ihrer Mutter einen letzten Wunsch zu erfüllen.