Blade Runner" kehrt in Form von Ridley Scotts definitivem Final Cut mit erweiterten Szenen und noch nie veröffentlichten Spezialeffekten zurück auf die Bildschirme - ein Fest fürs Auge, mit überragenden Action-Sequenzen und einem fesselnden Blick auf die Zukunft: Seit seinem Kinostart 1982 hat der Film nichts an Brisanz verloren. Blade Runner kehrt in Form von Ridley Scotts definitivem Final Cut mit erweiterten Szenen und noch nie veröffentlichten Spezialeffekten zurück auf die Bildschirme - ein Fest fürs Auge, mit überragenden Action-Sequenzen und einem fesselnden Blick auf die Zukunft: Seit seinem Kinostart 1982 hat der Film nichts an Brisanz verloren.
Los Angeles im November 2019: Der Stadtmoloch ist durchtränkt von Dauerregen. Die Stadt ist schmutzig, überbevölkert und die Menschen sind allgegenwärtiger Werbung ausgesetzt. Die Tiere sind fast ausgestorben und nur als teure, künstliche Wesen zu erhalten. Ein besseres Leben auf fernen Planeten wird versprochen, Welten, die durch so genannte "Replikanten" erschlossen worden sind. Da diese von der mächtigen Tyrell-Corporation hergestellten Androiden von Menschen äußerlich nicht mehr zu unterscheiden sind, jedoch über weit größere Kräfte verfügen als normale Menschen und im Laufe der Zeit eigene Gefühle und Ambitionen entwickeln, hat man ihnen eine Beschränkung der Lebensdauer auf vier Jahre eingebaut. Erinnerungen an eine real nicht existierende eigene Vergangenheit werden den Replikanten künstlich "einprogrammiert", wodurch ihre geistige Gesundheit sichergestellt werden soll. Den Replikanten ist es unter Androhung der Todesstrafe verboten, die Erde zu betreten. Für die Durchsetzung dieses Verbotes, also das Aufspüren und die Exekution von Replikanten, die dennoch auf die Erde gelangen, sind spezielle Polizeibeamte, die Blade Runner, verantwortlich.
Los Angeles im November 2019: Der Stadtmoloch ist durchtränkt von Dauerregen. Die Stadt ist schmutzig, überbevölkert und die Menschen sind allgegenwärtiger Werbung ausgesetzt. Die Tiere sind fast ausgestorben und nur als teure, künstliche Wesen zu erhalten. Ein besseres Leben auf fernen Planeten wird versprochen, Welten, die durch so genannte "Replikanten" erschlossen worden sind. Da diese von der mächtigen Tyrell-Corporation hergestellten Androiden von Menschen äußerlich nicht mehr zu unterscheiden sind, jedoch über weit größere Kräfte verfügen als normale Menschen und im Laufe der Zeit eigene Gefühle und Ambitionen entwickeln, hat man ihnen eine Beschränkung der Lebensdauer auf vier Jahre eingebaut. Erinnerungen an eine real nicht existierende eigene Vergangenheit werden den Replikanten künstlich "einprogrammiert", wodurch ihre geistige Gesundheit sichergestellt werden soll. Den Replikanten ist es unter Androhung der Todesstrafe verboten, die Erde zu betreten. Für die Durchsetzung dieses Verbotes, also das Aufspüren und die Exekution von Replikanten, die dennoch auf die Erde gelangen, sind spezielle Polizeibeamte, die Blade Runner, verantwortlich.
Bonusmaterial
- 3 Audiokommentare von Filmschaffenden zum neuen 'Final Cut', darunter auch ein Audiokommentar von Ridley Scott - Einleitung von Regisseur Ridley Scott
Wer Karl May und Perry Rhodan, "Game of Thrones" und Isaac Asimov schätzt, den wird auch Denis Villeneuves Verfilmung von "Dune" überzeugen.
Der Planet Arrakis hat seine Bestimmung verfehlt. Er hatte einmal die besten Anlagen zu einem Paradies, doch nun ist er eine Wüste. So weit das Auge blickt, ist alles mit Sand bedeckt. Unter dem Sand rumort es manchmal, dann regt sich der gigantische Wurm, der in den Dünen lebt. In einer anderen Hinsicht hat Arrakis seine Bestimmung allerdings ganz genau getroffen. Denn der Wüstenplanet ist ein Gleichnis. Frank Herbert, einer der Giganten der Science-Fiction-Literatur, hat es sich in den Sechzigerjahren ausgedacht und es dann in einen ausufernden Zyklus eingebaut, der sich aus heutiger Sicht wie eine Kreuzung aus "Game of Thrones" und Perry Rhodan, aus Karl Mays Mahdi-Romanen und Isaac Asimovs Foundation-Zyklus ausnimmt. Also ein Riesentext, der versucht, alles und noch ein bisschen mehr in sich aufzunehmen. Und der mit seinen wichtigsten Koordinaten sowohl in die Dekade passt, als das erste Wirtschaftswunder des entfesselten Ölzeitalters auf den sanften Widerstand von Blumenkindern stieß, wie auch in die Dekade, die nun in Windeseile einen kraftstoffsüchtigen Planeten dekarbonisieren soll.
Es liegt deshalb in der Luft, dass es noch einmal jemand mit einer Verfilmung von "Dune - Der Wüstenplanet" versuchen sollte. 1984 hat David Lynch seine Version vorgelegt, sie gilt allgemein als gescheitert; danach gab es im Jahr 2000 auch noch eine Miniserie, die den Spartenkanal, auf dem sie auftauchte, nie wirklich verließ. Nun aber bringt Denis Villeneuve seine Adaption in die Kinos. Und ist er nicht ein berufener Mann dafür? Ein vergleichsweise intellektueller Filmemacher, der sich mit "Blade Runner 2049" (der Fortsetzung eines Heiligtums des Science-Fiction-Kinos) nicht blamiert hat? Und der mit "Arrival" eines der klügsten Kontaktszenarien mit einer außerirdischen Spezies entworfen hat?
Villeneuve macht sich nicht nur gründlich Gedanken, er ist auch ein Ästhet. Seine Weltentwürfe sind zugleich außerweltlich wie genau mit der neuesten Forschung und den ältesten Mythologien abgestimmt. In "Blade Runner 2049" zeigte er einen Planeten, dem nicht nur die 1,5-Grad-Grenze, sondern eher die 4-Grad-Grenze innerhalb weniger Jahre entglitten war. Eine sonnenlose Welt, in der Las Vegas an die Wüste zurückgefallen war, aus der es sich mit pharaonischer Arroganz erhoben hatte.
Nach Arrakis war es schon damals nicht mehr weit. 2016 kaufte die Firma Legendary die Rechte zu Frank Herberts Roman, und heute kann man sich durchaus fragen, ob Villeneuve nicht schon bei "Blade Runner 2049" halb unbewusst an "Dune" dachte.
Er hat es nun allerdings doch mit einem deutlich anderen Genre zu tun. Denn die Replikanten-Mythologie vom "Blade Runner", die Ridley Scott 1982 auf Grundlage eines Romans von Philip K. Dick entwarf, wusste noch nicht viel von der Macht der Heldenzyklen und Sternenkriege, die sich damals im Kino gerade zu entfalten begann. Auch Villeneuves "Blade Runner 2049" fiel deutlich eher in die Rubrik Kultfilm. Mit "Dune" aber zielt er nun auf einen Brückenschlag: Er nimmt es mit "Star Wars" auf, versucht dabei aber immer noch, nicht zu tief in die Trivialreligion aus dem Universum von George Lucas hinabzusteigen.
Der Stoff gibt das auch her. Frank Herbert ist ein großer Synkretist und Enzyklopäde, er lässt es wimmeln von Völkern, Welten, Bünden und - mit "Game of Thrones" ist das wieder ein Codewort geworden - Häusern, also Dynastien. Im Kern ist aber auch "Dune" eine Erlösungsgeschichte, die stark von einem Effekt geprägt ist, den die Bibelexperten präsentische Eschatologie nennen - das heißt, dass die Endzeit oder die Zeit der Entscheidung schon angebrochen ist, weil ihr Vollstrecker schon da ist. Er muss nur erst erkannt oder vor Unheil bewahrt werden. Er heißt in diesem Fall Paul Atreides und stammt aus dem Haus, das zu Beginn des Films mit der Verwaltung des Planeten Arrakis betraut wird.
Die Atreiden sollen dabei vor allem für den Abbau des Rohstoffes Spice Sorge tragen, der für die Raumfahrt unabdingbar ist. Eine psychotrope Substanz, die jedes Kerosin alt aussehen lässt. Eine seltene Erde, die zu Schamanenreisen befähigt, so könnte man das auf die heutigen Verhältnisse auf dem Planeten Erde (oder Terra oder Gaia) umlegen. Spice ist aber eher das Erdöl der "Dune"-Welt, das wird aus den geopolitischen Anspielungen deutlich, die Villeneuve von Herbert übernimmt und zum Teil noch verstärkt.
Die Geschichte von "Dune" nennt offiziell ein 11. Jahrtausend als ihr Datum, sie steckt aber eben auch tief in den irdischen Weltaltern, und zwar von den alten Zivilisationen des Zweistromlandes bis zu antikolonialen Kämpfen an den Rändern des späten Osmanischen Reichs, von denen dann eben auch Karl May sich zu einer Reiseerzählung inspirieren ließ. Er fand "edle Wilde" nicht nur in Amerika, sondern auch in einer Gegend, in der bald darauf die ersten Quellen des schwarzen Golds zu fließen begannen. Zu den unvermuteten Ironien von "Dune" gehört dabei, dass Sand - bei Herbert noch das sinnlose Element, welches das Wesentliche verhüllt - inzwischen im richtigen Leben auch allmählich zu einem knappen Rohstoff wird.
Es ist vermutlich kein triviales Detail, dass die Atreiden bei ihrer Ankunft auf Arrakis einen Dudelsackspieler zuerst aussteigen lassen. Sie weisen sich damit als imperial aus, tragen aber auch die Frucht der Dissidenz in sich. Denn Paul Atreides, der Thronfolger, der junge Initiand in die Welt der Supermächte, entstammt einer Linie, die ihn zu Höherem als nur zu Statthaltertum auf einem Schürfplaneten befähigt. Pauls Mutter Jessica gehört zu dem Frauenorden der Bene Gesserit, einer quasifeministischen Zunft. Und so taucht auch schon früh eine Wahrsagerin auf, die nur an der Frage interessiert ist, ob Paul derjenige ist, auf den die Welt wartet. Der Messias, oder, um es mit dem in diesem Fall zutreffenderen Titel zu sagen: der Mahdi, also der muslimische Messias.
Das Blockbusterkino hatte in der letzten Zeit große Schwierigkeiten mit dem Umstand, dass mit der durchschlagenden digitalen Globalisierung und der zunehmenden Bedeutung von Identitätspolitiken die wichtigste Ressource zu versiegen droht: Es fehlt an Feinden, Feindbildern, allgemeiner gesprochen an plausiblen Anderen im Vergleich zum auch immer differenzierter werdenden Eigenen. Russen, Chinesen, Mexikaner, Araber, das war lange Zeit das Register, aus dem die Atombombenzündler kamen.
Inzwischen ist bei fast allen diesen Stereotypen Vorsicht geboten, und wenn schon nicht aus Gründen zunehmender Aufgeklärtheit, dann zumindest, um sich die Chancen auf Riesenmärkten wie dem der Volksrepublik China nicht zu verderben. "Star Wars" war gegen solche Probleme von Beginn an weitgehend gefeit, weil jede Allegorese nur ins Leere eines beliebig expandierenden Kunstmythos laufen konnte.
Denis Villeneuve aber stürzt sich mit Frank Herberts Hinterlassenschaft mitten in die Regionen, die für die Zukunft des Planeten Erde nach wie vor als neuralgisch gelten: Nordafrika und den Nahen oder Mittleren Osten, filmhistorisch die Welt von Lawrence von Arabien und die Welt, die James Cameron sich mit "Avatar" nur in einer fernen Dimension vorstellen konnte. Also eine Welt, in der ein ursprüngliches Volk - bei Cameron die Na'vi - das Wissen von ihr unter dem Sand (oder unter dem extraktiven Überbau) bewahrt.
Bei Herbert trägt das dieses Volk den sprechenden Namen Fremen. Und wenn Paul Atreides der Mahdi ist, dann muss er wohl die Seite wechseln und sich den Fremen anschließen. Dass ihm aus seinen Träumen von Anfang an ein hübsches Mädchen mit entsprechend indigenem Look (und einer "typisch" ornamentalen Nasenringkonstruktion) zulächelt, ist die vielleicht deutlichste von doch einigen Kitsch-Konzessionen, die Villeneuve hier für das größere Ganze in Kauf nimmt. Zu diesem Ganzen gehört auch, dass sein "Dune" mittendrin aufhört und auf einen zweiten Teil verweist, den sich das Publikum durch fleißigen Erwerb von Eintrittskarten quasi erkaufen muss.
Vermutlich wird Paul Atreides sich in diesem zweiten Teil dann auch so entwickeln, dass er den Übergang von muslimischer zu ökologischer Befreiungstheologie locker plausibel macht. Denis Villeneuve hat die Hauptrolle Timothée Chalamet anvertraut, einem jungen Schauspieler, den man eher mit geschlechterfluider Sensibilität assoziiert als mit dem Abwehrkampf gegen tyrannische Gegner. Aber das war ja immer schon die Rolle der Prophetie und der charismatischen Führerfiguren: Sie stellten sich mit Soft Power gegen Formationen der Verhärtung.
Gerade mit diesen Formationen aber bekommt "Dune" seine besten Momente. Villeneuve hat seine Stärke in der Inszenierung jener Welt, die Paul Atreides verlässt, um in die Wüste hinauszuziehen. Bei so mancher Massenszene könnte man meinen, er habe sich vielleicht von Zhang Yimous "Hero" inspirieren lassen, diesem historischen Sinnbild für die neue chinesische Großmacht. Eine präzise Semantik muss man "Dune" aber gar nicht unterschieben, denn die entscheidende Konstellation besteht ja darin, dass man auf einem Planeten (in einer Welt) immer zugleich gemeinsam "im selben Boot" sitzt und doch um die Steuerung dieses Boots kämpfen muss.
"Dune" ist dabei - wie so viele Akteure in solchen Situationen - zugleich Teil einer Lösung wie Teil des Problems. Als Exodus-Geschichte gibt der Film ein hilfreiches Motiv vor. Weil ihm als Orientierung aber nichts Besseres einfällt als ein romantisches Völkchen, unterbietet er doch deutlich die Komplexität der mythischen Formen, die er nach Kräften bemüht. Arrakis fällt so letztendlich auch hinter seine Bestimmung als Gleichnis zurück.
BERT REBHANDL.
Ab Donnerstag im Kino
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

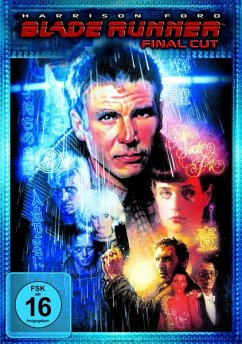





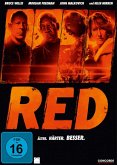

 FSK: Freigegeben ab 16 Jahren gemäß §14 JuSchG
FSK: Freigegeben ab 16 Jahren gemäß §14 JuSchG