Freddie Mercury arbeitet am Flughafen und streift nachts durch die Musikclubs. Dort lernt er die Band Smile kennen und bietet ihr an, als Sänger einzuspringen. Sie lachen, lassen sich aber schließlich von einer Gesangsprobe überzeugen. Nach einer Kneipentour mit dem VW-Bus quer durchs Land investieren sie ihr letztes Geld in eine Plattenaufnahme, mit der sie einen Vertrag bei einem Studio landen. Der Beginn einer steilen Karriere und einer auch turbulenten Freundschaft. Quelle/Copyright: Entertainment Media Verlag
Bonusmaterial
Bonusmaterial
- UHD: Die komplette Live Aid Performance
- BD: Wie aus Rami Malek Freddie wird Der Look und Sound von Queen Live Aid Die komplette Live Aid Performance u.a.

Der Film "Bohemian Rhapsody" erzählt von der Rockband Queen und deren Sänger Freddie Mercury, ohne sich dafür zu interessieren, wie es war, und fast ohne Regie. Beides vermisst man aber nicht, wenn man hört, worauf es hier ankommt.
Er greift über sich selbst hinweg aus dem Bett, wo er neben der Frau liegt, die er heiraten will. Da oben warten Tasten darauf, dass seine Hände die ersten paar Noten des Stücks anspielen, das diesem Film den Titel leiht. Kunst geht den besten Kunstschaffenden stets über den eigenen Horizont, sie ist immer ein bisschen aus der Luft gegriffen: "Bohemian Rhapsody" will mit Szenen wie dieser die These glaubhaft machen, dem Helden des Films, Freddie Mercury, Sänger der Rockband Queen, sei sein Talent im Grunde zu hoch gewesen. Mehrfach zieht der Mann, das heißt: Rami Malek, der ihn spielt, sich aus der schöpferischen Selbstverschwendung im Studio oder Stadion in zart und respektvoll fotografierte Momente des stillen Staunens darüber zurück, dass er das alles wirklich kann und ist, was die Leute an ihm anbeten.
Gerade (und wohl: nur) in diesen Augenblicken rückt er dem Kinopublikum nahe, weil es auch nicht fassen kann, dass einer wie Mercury tatsächlich mal gelebt hat, hauptsächlich auf Bühnen.
Der Film hat und braucht keine Ideen, keine verblüffenden Handlungswendungen, keine Besetzungsüberraschungen, keine authentischen Wackelkameras. Er ist nicht analytisch, politisch, kritisch, wahr oder tiefer als eine Schicht Rouge auf den Wangen. Gott sei Dank: Man wünscht den Nachgeborenen, die mit Reality-Shows und Echtzeit-Promiklatsch im Netz aufgewachsen sind, mehr solche Filme, damit sie beim Planschen in der Infokloake, zu der die Popkultur gerade verkommt, nicht vergessen, was Fiktion ist und wozu man das braucht (damit man nicht religiös wird nämlich, weil das Diesseits uns Menschen nun mal nicht genügt, da wir uns unser Leben selbst erfinden müssen, wenn auch nie aus freien Stücken).
Wie lange ist es her, dass so verklemmt wie im aktuellen Gerede über "Bohemian Rhapsody" an der Inszeniertheit und freimütigen Plattheit eines Films herumgebeckmessert wurde, der nichts weiter zu sein und zu können behauptet als die offiziell abgesegnete Selbstbeweihräucherung samt Erinnerungsarbeit einer Rockgruppe?
Sieht man sich audiovisuelle Original-Dokumentaraufnahmen von Queen an (am besten die allerbeste, aufgenommen in Montreal 1981), erfährt man Mercury als einen, der besser konnte, was er tat, als andere, weil er mehr Spaß dran hatte als alle, und umgekehrt - ein funkensprühender Regelkreis der legitimen Selbstverehrung, der nur von außen zerstört werden konnte (und auch wurde, von einem saudummen Virus). Der Titel seiner edelsten Arie lautet "Somebody to Love", was bei einem berufsmäßigen Narzissten etwas ganz anderes bedeutet, als wenn die Nummer "Somebody to be Loved by" hieße: Geliebtwerden oder nicht, das war nie sein Problem, auch wenn er die Stimmen der Sehnsucht, des Defizits, der Verlassenheit ebenso sicher aus sich sprechen lassen konnte wie die der Lust. Der Mann, dessen selbst ausgesuchter Nachname "Quecksilber" war, konnte jubeln und klagen wie keiner, das teilt der Film treu mit, auch wenn die Gitarrenspuren, die ihn dabei unterstützen, hier und da ein bisschen lauter hätten sein dürfen (wir Altfans sind schwerhörig, erfahrungsdumm und leicht zu beeindrucken, aber nach den ersten Takten von "Keep yourself alive" hat "Bohemian Rhapsody" uns in der Tasche).
Die Entstehungsgeschichte des Films ist eine der langsam und qualvoll herbeigenötigten Unterwerfung seiner Produktion unter die PR-Zwecke der überlebenden Queen-Mitglieder, also des Gitarristen Brian May, des Bassisten John Deacon und des Schlagzeugers Roger Taylor.
Der nominelle Regisseur Bryan Singer war zwischendurch unbekannt verschollen, aber das Ding braucht und hat eigentlich ohnehin keine Regie, denn es beschwört einen Geist, dessen Autorschaft athletisch und anzüglich, stark und taumelnd bei seinem Hauptgegenstand zu liegen vorgibt, einem Traum in Uniformjäckchen mit Scheinschultern, Harlekinhosen aus Spandex, Tarzanarmbändern und Dauerwellenbrusthaaren. Alles sonst ist Nebenrolle: Ben Hardy gibt den Roger Taylor als smarte Maus mit Mumm, Joseph Mazzellos John Deacon legt seine Kraft in die Ruhe, Gwilym Lee erkennt in Brian May den Klassensprecher, Schwiegersohn und Weihnachtsengellockenträger, der er tatsächlich ist.
Rami Malek wiederum, der Star, ist zwar hübscher, als Freddie Mercury war, aber Freddie Mercury war dafür schöner, als Rami Malek ist, besser kann man's nicht ausbalancieren. Die Bewegungen des Schauspielers bleiben hinter denen des Vorbilds angemessen zurück: im Flüssigen etwas weniger fließend, im Eckigen weniger herrisch, so wird ein Sicherheitsabstand eingehalten, um den sich eine filmische Anverwandlung bemühen muss, anders als die Imitatorennummer im Varieté: Alles richtig hier, inklusive die Mundprothese, die den legendären Zahnüberschuss des Sängers nachbildet, an dem er nie etwas ändern ließ, weil er glaubte, nur so die mythische Vier-Oktaven-Reichweite seiner Stimme bewahren zu können. Kunst ist ein Großmaul, sonst ist sie nichts. Das erkennt in der Spielhandlung zuerst die große Liebe Mary Austin; als Lucy Boynton in dieser tragenden Rolle sagt: "I like your style", ist das der Zauberspruch, der den Helden aus seinen letzten Kokonresten befreit, und sie ist es auch, die ihm sagt, dass er schwul sei (womansplaining, mal was anderes).
Als Mercurys Bandkollegen bei seinen Eltern samt Schwester zu Gast sind, um seinen Geburtstag zu feiern, spielt er sich selbst ein Ständchen und gratuliert sich zum neuen Namen: Der in Sansibar-Stadt geborene, in Indien aufgewachsene Farrokh Bulsara, den verblödete Kollegen beim Flughafen-Gepäckhelferjob für einen "Paki" halten, wird damit abgeschafft, und als der Vater mahnt, niemand könne je etwas werden, der etwas anderes sein wolle als das, was er ist, kann der Sohn nicht zustimmen, sowenig, wie er später bereit ist, als HIV-positiver Künstler den Posterboy für Mitleid abzugeben oder das abschreckende Beispiel. Was war er, was wollte er? "Performer" sein, sagt Rami Malek, und sein Freddie Mercury bleibt das auch auf dem Korridor, wo ein junger Mann in einem der unförmigen Jeansanzüge jener Zeit im Wartezimmer sitzt, mit den Krankheitsmalen der neuen Epidemie am Leib, und den Star zum kurzen Duett einlädt, der dem Wunsch gern entspricht. Unterhaltung ist etwas Todernstes.
Witze gehören natürlich auch dazu, von der mit E-Gitarren gespielten 20th-Century-Fox-Fanfare zu Filmbeginn bis zum dem Moment, in dem ausgerechnet Mike Myers, einst Titelheld von "Wayne's World" (1992), dem Film, in dem das Headbangen im Auto zur Holterdipolterstelle des Songs "Bohemian Rhapsody" das erste Zeichen dafür war, wie hochvital Mercurys Performance seinen Tod überstehen würde, in dem Film, der jetzt so heißt wie das Lied, einen Plattenfirmentrottel spielt, der sagt, dass er nicht glaubt, dass Jugendliche jemals im Auto zu "Bohemian Rhapsody" headbangen werden. "Tragödie" ist etwas bei Shakespeare, wenn die wichtigsten Figuren sterben, aber "Komödie" ist beim selben Autor, wenn die wichtigsten Figuren heiraten, weil sie füreinander bestimmt sind. Die Komödie überwiegt in "Bohemian Rhapsody", denn füreinander bestimmt sind der Sänger und sein Publikum, und die heiraten andauernd, dass es nur so Sterne spritzt.
Pathos als Euphorie, Euphorie als Pathos, "Don't Stop Me Now" und "Who Wants to Live Forever" - man könnte eine ganze Pop-Anthropologie aus Queen-Songtiteln bauen, und sie wäre nicht dümmer als irgendwas, was in akademischen Fächern vom Menschen jeden Tag an allen Unis so zusammengeforscht wird. Ein Kritiker der mangelnden Bereitschaft des Feuilletons, sich für Kitsch zu begeistern, meinte neulich, das Schlimme daran sei eine " elitäre Kunstauffassung". Darauf kommen nur Leute, die auf Privatschulen waren - Feuilletonismus im schlechten Sinn ist doch gar nicht elitär, Freddie Mercury war viel elitärer (macht nur mal die Augen auf und schaut euch diese Präsentation an, demokratisch geht anders). Das Allerelitärste ist (im Guten wie, manchmal, wie jetzt in Brasilien, im Bösen) sowieso das Allerpopulärste, nämlich die Stimme, die sich an die Masse wendet, indem sie allen Einzelnen darin suggeriert, man unterhalte sich von Meisterschaft zu Empfänglichkeit, von oben nach unten. Autorität muss ein bisschen rätselhaft sein, um zu funktionieren - keine Sau weiß, worum es im Song "Bohemian Rhapsody" überhaupt geht, was Galileo, Scaramouche und Figaro darin zu suchen haben, aber als der Plattenfirmenidiot sich genau darüber beschwert, reagiert Freddie Mercury, der bis in die Titel letzter Werke ("Innuendo"!) wusste, dass das Unverständliche das Allgemeingültige sein kann, mit der berechtigten Arroganz des Götterlieblings.
Ein schlüssiges Bild von irgendwas Gewesenem ist im Magnetfeld dieser Arroganz nicht zu haben, der Schlüssel "Band" klärt da auch nichts, denn das Wort heißt hier mal "Familie", mal Gruppe von eigentlich unvereinbaren Außenseitern, die für alle anderen Außenseiter musizieren. Dem Film geht es nicht darum, "wie es war", nicht um die Begleitumstände des Wembley-Konzerts, nicht um die Münchner Zeit des Sängers, nicht um dessen letzte Tage mit Jim Hutton, auch wenn das alles irgendwie vorkommt, teils total verlogen.
Es geht um die Spannung zwischen dem Massenkunstwerk Queen und den im Rückblick sehr unheimlichen Selbstentblößungen Mercurys in seinen Solosachen ("The Great Pretender", "Living On My Own") - kein Film könnte in sich zersplitterter sein als jener süße und harte, stumpfe und raffinierte Riesenangeber, dem "Bohemian Rhapsody" kopflos episodisch, praktisch regiefrei und begeistert hinterherhechelt, aus Neugier wie aus selbstapologetischem Interesse der drei Band-Überlebenden. Es ist wie immer bei eher komischen statt tragischen Opern: Man darf kein Wort und kein Bild glauben, aber jeden vor- und nachgesungenen Ton.
DIETMAR DATH
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

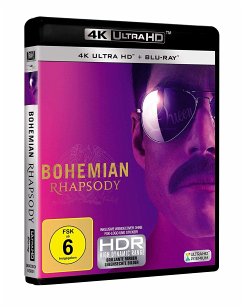







 FSK: Freigegeben ab 6 Jahren gemäß §14 JuSchG
FSK: Freigegeben ab 6 Jahren gemäß §14 JuSchG