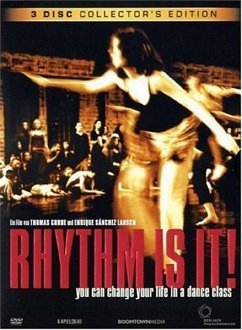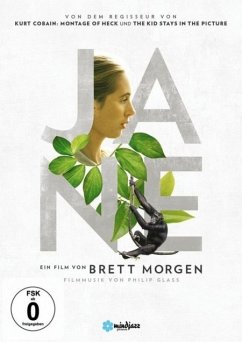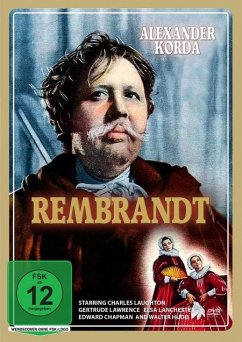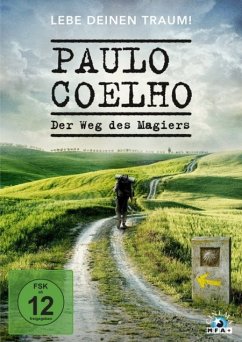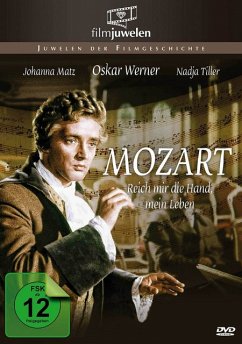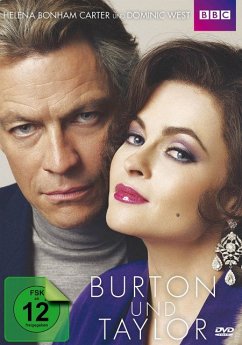Born to be Blue

PAYBACK Punkte
4 °P sammeln!
BORN TO BE BLUE erzählt von einem Wendepunkt im Leben des legendären Jazz-Trompeters Chet Baker (Ethan Hawke). Nach einem kometenhaften Aufstieg in den 1950er Jahren, gefeiert als der "James Dean of Jazz" und "King of Cool", war Baker schon zehn Jahre später am Ende. Zerrissen von seinen inneren Dämonen und den Exzessen des Musikerlebens, begegnet er einer Frau (Carmen Ejogo), mit der wieder alles möglich scheint. Angefeuert von seiner neuen Leidenschaft und ihrem bedingungslosen Glauben an ihn, kämpft sich Baker wieder zurück und erschafft so einige der unvergesslichsten Aufnahmen sein...
BORN TO BE BLUE erzählt von einem Wendepunkt im Leben des legendären Jazz-Trompeters Chet Baker (Ethan Hawke). Nach einem kometenhaften Aufstieg in den 1950er Jahren, gefeiert als der "James Dean of Jazz" und "King of Cool", war Baker schon zehn Jahre später am Ende. Zerrissen von seinen inneren Dämonen und den Exzessen des Musikerlebens, begegnet er einer Frau (Carmen Ejogo), mit der wieder alles möglich scheint. Angefeuert von seiner neuen Leidenschaft und ihrem bedingungslosen Glauben an ihn, kämpft sich Baker wieder zurück und erschafft so einige der unvergesslichsten Aufnahmen seiner Karriere.