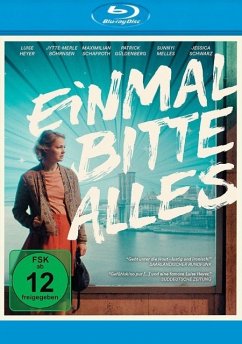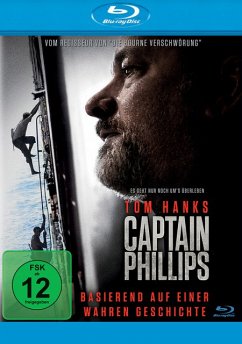Captain Fantastic - Einmal Wildnis und Zurück

PAYBACK Punkte
5 °P sammeln!
Der hochgebildete Ben (Viggo Mortensen) lebt aus Überzeugung mit seinen sechs Kindern in der Einsamkeit der Berge im Nordwesten Amerikas. Er unterrichtet sie selbst und bringt ihnen nicht nur ein überdurchschnittliches Wissen bei, sondern auch wie man jagt und in der Wildnis überlebt. Als seine Frau stirbt, ist er gezwungen mitsamt der Sprösslinge seine selbst geschaffene Aussteigeridylle zu verlassen und der realen Welt entgegenzutreten. In ihrem alten, klapprigen Bus macht sich die Familie auf den Weg quer durch die USA zur Beerdigung, die bei den Großeltern stattfinden soll. Ihre Reise...
Der hochgebildete Ben (Viggo Mortensen) lebt aus Überzeugung mit seinen sechs Kindern in der Einsamkeit der Berge im Nordwesten Amerikas. Er unterrichtet sie selbst und bringt ihnen nicht nur ein überdurchschnittliches Wissen bei, sondern auch wie man jagt und in der Wildnis überlebt. Als seine Frau stirbt, ist er gezwungen mitsamt der Sprösslinge seine selbst geschaffene Aussteigeridylle zu verlassen und der realen Welt entgegenzutreten. In ihrem alten, klapprigen Bus macht sich die Familie auf den Weg quer durch die USA zur Beerdigung, die bei den Großeltern stattfinden soll. Ihre Reise ist voller komischer wie dramatischer Momente, die Bens Freiheitsideale und seine Vorstellungen von Erziehung nachhaltig infrage stellen...

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.