Eine Gruppe Computerfreaks filmt heimlich ein abgehalftertes Starlett beim Sex und setzt die Aufnahmen ins Internet. Als die Publicity jedoch die Karriere der Schauspielerin wieder ankurbelt, melden sich plötzlich sämtliche gescheiterten Hollywood-Exstars, um in der neuesten Produktion der Jungs mitspielen zu dürfen.

Wir nehmen noch einmal Abschied von Philip Seymour Hoffman, erleben Julianne Moore als Blondine und Cameron Diaz in Panik
Ob das nun wirklich der allerletzte Film ist, den Philip Seymour Hoffman gedreht hat, bevor er am 2. Februar dieses Jahres im Alter von nur 46 Jahren starb, das spielt angesichts des Verlusts keine Rolle. Es ist ein Glück, dass es diesen Film gibt, und deswegen ist auch nicht so wichtig, dass Hoffman natürlich einen großartigeren Abschied verdient gehabt hätte.
Er ist das Gravitationszentrum von "A Most Wanted Man", der Verfilmung von John Le Carrés Thriller "Marionetten"; seine Hartnäckigkeit, seine Hoffnung, seine Verzweiflung, seine Wut sind es, die den Film vorantreiben, auch wenn sein Gang so schwerfällig und müde wirkt. Als alternder, heruntergekommener Spion, der zu viel raucht und zu viel trinkt, der sich mit allen möglichen Leuten anlegt, aber seine Mitarbeiter anständig behandelt, der mit selbstzerstörerischem Starrsinn seinen Weg verfolgt, als Günther Bachmann ist Hoffman auf der Höhe seines Könnens.
Bachmann ist Leiter einer Antiterroreinheit in Hamburg, er liegt im Clinch mit dem Verfassungsschutz und mit den Amerikanern. Er weigert sich, einen verdächtigen jungen Tschetschenen festzunehmen, der wie aus dem Nichts in Hamburg aufgetaucht ist und das Erbe seines Vaters antreten will, das in einer Privatbank liegt. "Lipizzanerkonten" ist der schöne Ausdruck für dieses Vermögen, benannt nach den Pferden, die dunkel zur Welt kommen, um allmählich zu Schimmeln zu werden. Bachmann hat den Jagdinstinkt und auch die Strategie, in welcher der junge Mann nur als Köder dient, um einen scheinbar unbescholtenen, moderaten muslimischen Gelehrten zu überführen.
Wie dieser Plan Gestalt annimmt und was seine Ausführung bedroht, das ist, wie immer bei Le Carré, makellos konstruiert. Da wird kein Plot umständlich ausbuchstabiert, da hat auch kein Fernsehredakteur eine Erklärszene verlangt. Wie in einem Puzzle kommen Steine zusammen, die einander ähneln und deren genauer Platz sich nicht auf den ersten Blick erschließt. Für dieses Verfahren ist ein Regisseur mit einem Hang zum Minimalismus wie Anton Corbijn eine sinnvolle Wahl. Mitunter inszeniert der gelernte Fotograf Corbijn allerdings die Schauplätze etwas zu kunstvoll, als wollte er City Design betreiben und sich unbedingt an eher abstrakten Motiven versuchen - aber er zeigt dabei eben auch, welch ein großartiger Drehort das alte und das neue Hamburg noch immer oder jetzt wieder ist.
Dass die Charaktere außer Bachmann oft nur wie Skizzen wirken, vor allem die weiblichen, das war schon im Roman so. Corbijn hat kaum etwas unternommen, um das zu ändern, was mehr als bedauerlich ist, wenn man mit Schauspielern wie Robin Wright (als amerikanische Agentin) und Willem Dafoe (als Bankier) arbeiten kann oder mit Nina Hoss und Daniel Brühl (als Bachmanns Mitarbeiter)
So schaut man zu, wie die Geheimdienste einander belauern, wie der Film altmodisch-langatmig, bisweilen dann auch etwas langweilig und mit (zumindest in der deutschen Fassung) sehr schlichten Dialogen auf den Showdown zusteuert. Man hat ja Hoffmans Bachmann, an den man sich halten kann, und man hat genug Zeit festzustellen, dass die Geschichte sich auch aus der Konstellation der Fortbewegungsmittel entwickeln ließe. Bachmanns solider, schwerfälliger, aber unverwüstlicher Mercedes 450 neben dem vereinsamenden schwarzen Mercedes-Zweisitzer des Bankiers, der schwarze Alfa Romeo, den man Bachmanns Assistentin Erna (Nina Hoss) mit ihren blaustrümpfigen Blusen nicht zugetraut hätte, dazu das Fahrrad der naiven jungen Anwältin (Rachel McAdams), die von vornherein abgehängt wird. Und am Ende kommen klobige schwarze SUVs.
Dann knallt Bachmann in der letzten Einstellung die Tür seines Mercedes zu, schließt ab, die Kamera verharrt noch auf dem Rücksitz, als er längst aus dem Blickfeld verschwunden ist. Das ist ein gutes Bild dafür, wie sehr uns Philip Seymour Hoffman jetzt schon fehlt.
Seit Hollywood mehr ist als ein Dorf inmitten von Zitrushainen, seit gut hundert Jahren also, da ist es für alle Tugendwächter und Boulevardjournalisten auch ein Synonym für Sünde, Gier und Wahn. Kenneth Anger hat das mit seinem berühmten Skandalbuch "Hollywood Babylon" ja nicht erfunden, es lag in der Luft, es musste nur entsprechend ausgedeutet, ausgebeutet und ausgeweidet werden. In dieser Verwertungskette ist der Autor Bruce Wagner ein Spätgeborener, er hat 1993 die Serie "Wild Palms" geschrieben, dazu Romane, die mehr sein sollen als Satire, die abrechnen mit Hollywood, die weh tun wollen.
Interessant wird das, wenn ein Regisseur wie David Cronenberg Feuer fängt, der vor "Maps to the Stars" noch keinen einzigen Tag in Hollywood gedreht hatte und der nun im Alter von 71 Jahren mit einem gewissen Staunen eine Woche dort gearbeitet hat. Der Titel des Films beschreibt ein Elend und ein Gewerbe, das jeder kennt, der mal in Hollywood war: Leute, die zum Beispiel am Sunset Boulevard auf Campingstühlen hocken und Stadtpläne verkaufen, auf denen die Häuser der Stars markiert sind. Man fährt dann vorbei, schaut, und wenn man zu lange schaut, kommt bald auch die Polizei.
Von Wagner und Cronenberg erfährt man nun, was hinter Mauern, Toren und Türen angeblich los sein soll. Wagners Skript wirkt dabei, als habe er zu viel Adorno gelesen: dass allein Übertreibung heute das Medium von Wahrheit sei. Zumindest sehen die Charaktere aus, als wären sie nach diesem Prinzip entworfen. Havana (Julianne Moore), ein Star im Niedergang, die unbedingt die Rolle spielen will, die ihre Mutter berühmt machte; der 13-jährige Kinderstar Benji, der schon einen Drogenentzug hinter sich hat; seine ältere Schwester Agatha (Mia Wasikowska), die von einer Therapie zurückkehrt, weil sie das elterliche Haus angezündet hat, und die nun Havanas Assistentin wird; die Eltern, ein schmieriger Therapie-Guru der Vater (John Cusack), die Mutter Benjis Agentin, beide wie ferngesteuert, in einem neuen Haus, in dem man nicht leben, sondern nur sein Leben zur Schau stellen kann.
Man kann die Aufzählung hier ruhig abbrechen, allenfalls noch ergänzen, dass in dieser Psychopathologie des Hollywood-Alltags auch Gespenster vorkommen. Man hat rasch begriffen, dass die glänzenden Oberflächen der wahre Abgrund sind - und dass es von allem ein bisschen zu viel gibt. Wenn man schon im Modus der grellen Übertreibung einsetzt, ist eine Steigerung im Lauf des Films naturgemäß schwierig. In jedem Fall erlebt man hier nicht unbedingt den David Cronenberg, den man kennt. Das war aber schon in der Verfilmung von Don DeLillos "Cosmopolis" so. Auch "Maps to the Stars" wirkt zu ausgedacht, erdrückt vom Konzept, kaum interessiert an der Wandlungs-, Leidensfähigkeit und Leidenswilligkeit des menschlichen Körpers, wie Cronenberg das in "Crash", in der "Fliege" oder den "Unzertrennlichen" war; nicht ansatzweise so fasziniert von den Ausformungen physischer und psychischer Gewalt wie in "Tödliche Versprechen" oder "A History of Violence".
In jenen Abgrund, der das Filmgeschäft sein soll, hat man schon ein paar Mal zu oft geschaut, als dass einen dieser müde Reigen gutsituierter Freaks noch schrecken könnte. Was bleibt von diesen "Maps"? Natürlich die fabelhafte Rothaarige Julianne Moore als Blondine - eine Sensation. Und der beste Dialog, den sollte man sich auch merken: "Was ist die Hölle?" - "Eine Welt ohne Drogen."
Selten war ein Titel eine größere Lüge. Aber das war abzusehen, wenn eine Hollywood-Komödie "Sex Tape" heißt. Sie hat mit allem Möglichen zu tun, nur nicht mit Sex, allenfalls in einem technischen Sinne - und das, obwohl Cameron Diaz mitspielt. Selten war es auch eine gute Idee, ein erfolgreiches Komödienteam mit einem schlechten Drehbuch sofort wieder ins Rennen zu schicken - und das, obwohl Cameron Diaz mitspielt. Dennoch hat Jake Kasdan, der Sohn des in Hollywoods Abgründen verschollenen Lawrence, nach "Bad Teacher" nun mit Jason Segel und Cameron Diaz dieses "Sex Tape" gedreht. Die Ausgangsidee ist sagenhaft dürftig. Zu Collegezeiten hatten Annie und Jay supertollen Sex. Zehn Jahre später haben sie zwei Kinder, er verantwortet das Musikprogramm eines Radiosenders, sie schreibt ein Blog übers Muttersein, und sie wundern sich, dass der Sex nicht mehr so scharf und häufig ist wie früher (wobei er im "Früher" des Films eher nach fürs Nachmittagsprogramm geeigneten Turnübungen aussieht). Weshalb sie ein Sex Tape drehen, das sie als Adaption des steinalten Ratgeber-Bestsellers "The Joy of Sex" anlegen. Durch ein dummes Versehen gerät das Video in die Cloud, maximale Peinlichkeit droht, und so ziehen sie panisch los, um all die iPads einzusammeln, die Jay verschenkt hat und die nun synchronisiert wurden.
Technisch gesehen müsste man diese Idee infantil nennen - wenn nicht die meisten Kinder heute genau wüssten, wie man das Problem ganz leicht hätte lösen können. Dramaturgisch betrachtet sorgt sie für krachend peinliche Szenen, in denen unter anderem auch ein deutscher Schäferhund eine traurige Rolle spielt. Und in lebenspraktischer Perspektive müsste man Annie und Jay einen Paartherapeuten oder gleich einen Scheidungsanwalt empfehlen, der darauf hinwiese, dass auch Paarbeziehungen gewissen Entwicklungen unterliegen.
Das größte Versäumnis eines Films jedoch, in dem Cameron Diaz mitspielt, die ebenso umwerfend komisch sein kann wie glamourös und sexy, der liegt darin, dass Jake Kasdan so etwas wie Erotik nicht mal erkennen würde, wenn sie direkt vor der Kamera sichtbar würde. Sex ist hier nur ein weiteres Anwendungsfeld der Ratgeberliteratur. So wie man sich Yoga, Golf, Rosenzucht oder Töpferei hingeben kann, so kann man auch Sex als Hobby und Mittel zur Selbstoptimierung ausüben. Und wenn es nicht so richtig klappt, gibt es sicher eine passende App mit Gebrauchsanweisung für Stellungswechsel und Rollenspiele. Das ist auf eine derart erschreckende Weise steril und verklemmt, dass einem alles Lachen im Halse stecken bleibt.
PETER KÖRTE
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main






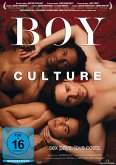


 FSK: Freigegeben ab 16 Jahren gemäß §14 JuSchG
FSK: Freigegeben ab 16 Jahren gemäß §14 JuSchG