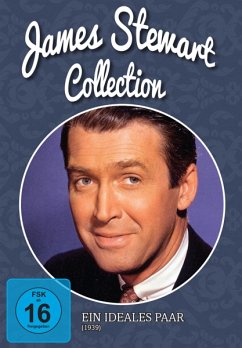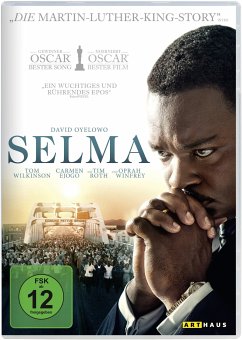Das schönste Paar
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
18,99 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
9 °P sammeln!
Die beiden Lehrer Liv und Malte sind ein glückliches Paar, das seinen romantischen Sommerurlaub auf einer Mittelmeerinsel genießt. Als ein plötzlicher Überfall durch drei Jugendliche in einen sexuellen Übergriff mündet, wird ihr bisheriges Leben aus der Bahn geworfen. Zwei Jahre später. Das Paar hat an seiner Beziehung festgehalten und erstaunliche Stärke im Umgang mit dem traumatischen Erlebnis bewiesen. Doch dann begegnet Malte zufällig ihrem Peiniger. Getrieben von der Sehnsucht nach Gerechtigkeit, nimmt er die Verfolgung des Täters auf und setzt damit die gerade zurückgewonnene ...
Die beiden Lehrer Liv und Malte sind ein glückliches Paar, das seinen romantischen Sommerurlaub auf einer Mittelmeerinsel genießt. Als ein plötzlicher Überfall durch drei Jugendliche in einen sexuellen Übergriff mündet, wird ihr bisheriges Leben aus der Bahn geworfen. Zwei Jahre später. Das Paar hat an seiner Beziehung festgehalten und erstaunliche Stärke im Umgang mit dem traumatischen Erlebnis bewiesen. Doch dann begegnet Malte zufällig ihrem Peiniger. Getrieben von der Sehnsucht nach Gerechtigkeit, nimmt er die Verfolgung des Täters auf und setzt damit die gerade zurückgewonnene Stärke, vor allem aber das Vertrauen und die Liebe von Liv aufs Spiel.