Mehr als zwei Drittel der Erde sind von Wasser bedeckt und trotzdem wissen wir mehr über die Oberfläche des Mondes als über die Tiefen unserer Weltmeere. Deep Blue präsentiert eines der letzten großen Geheimnisse unseres Planeten - die Welt der Ozeane.
Die Reise führt von flachen Korallenriffen über die unwirtlichen Küsten der Antarktis in die Weiten des offenen Meeres bis hin zu den tiefsten Tiefen der Ozeane in die ewige Dunkelheit. Spektakuläre Aufnahmen von tanzenden Delphinen, jagenden Haien und Walen wechseln zu fischenden Eisbären und riesigen Armeen von Krabben, die über den Strand rasen.
Die Kamera schießt durch gigantische Fischschwärme und dringt vor bis zum tiefschwarzen Meeresboden, wo bizarre Leuchtfische, Würmer und Quallen ein farbenfrohes Feuerwerk zaubern. Deep Blue gehört zu den außergewöhnlichsten und aufwändigsten Projekten, die je im Bereich des Dokumentarfilms realisiert wurden und zeigt das Leben der Ozeane in all seiner atemberaubenden Schönheit und ungebändigten Wildheit.
Die Reise führt von flachen Korallenriffen über die unwirtlichen Küsten der Antarktis in die Weiten des offenen Meeres bis hin zu den tiefsten Tiefen der Ozeane in die ewige Dunkelheit. Spektakuläre Aufnahmen von tanzenden Delphinen, jagenden Haien und Walen wechseln zu fischenden Eisbären und riesigen Armeen von Krabben, die über den Strand rasen.
Die Kamera schießt durch gigantische Fischschwärme und dringt vor bis zum tiefschwarzen Meeresboden, wo bizarre Leuchtfische, Würmer und Quallen ein farbenfrohes Feuerwerk zaubern. Deep Blue gehört zu den außergewöhnlichsten und aufwändigsten Projekten, die je im Bereich des Dokumentarfilms realisiert wurden und zeigt das Leben der Ozeane in all seiner atemberaubenden Schönheit und ungebändigten Wildheit.
Bonusmaterial
DVD-Ausstattung / Bonusmaterial: - Kinotrailer - Kapitel- / Szenenanwahl
In Musik ertränkt: "Deep Blue", eine Meeresdokumentation von Alastair Fothergill und Andy Byatt
Wenn ich mir ein Glas Zuckerwasser bereiten will, "muß ich das Schmelzen des Zuckers abwarten", hat der Denker der Dauer, Henri Bergson, einmal gesagt. Der Theoretiker des Bewegungsbildes, Gilles Deleuze, hielt diesen Gedankengang für etwas merkwürdig, "da Bergson anscheinend vergißt, daß Umrühren mit einem Löffel die Auflösung beschleunigen kann". Natürlich ist Deleuzes Einwand nur rhetorisch, auch ihm geht es wie Bergson um die Produktivität der geistigen Prozesse in dem, der abwarten kann. Was aber dabei herauskommt, wenn man die Geduld verliert und vor der Zeit zum Löffel greift, davon legt der gerade in die Kinos gekommene Film "Deep Blue" Zeugnis ab.
Dabei waren die Entstehungsbedingungen für den Film, der in die Geheimnisse des Ozeans einführen will, die besten. Die Regisseure - Alastair Fothergill und Andy Byatt - konnten auf ein umfangreiches, siebentausend Stunden umfassendes Bildmaterial zurückgreifen, das zwanzig Filmteams in fünfjähriger Arbeit in und auf den Weltmeeren gesammelt hatten. Die Bilder des Films sind bereits in der BBC-Naturdokumentationsserie "The Blue Planet" auf ihre Tauglichkeit geprüft worden. Und das Produktionsteam des Films war auch für Jacques Perrins Zugvögel-Dokumentation "Nomaden der Lüfte" (2001) verantwortlich.
Das sind für Naturfilme die zur Zeit besten Referenzen, die man vorweisen kann. Am Anfang von "Deep Blue" merkt man das auch für vielleicht eine Minute. Die Kamera zeigt fliegende Albatrosse, die mit kleinsten Flügel- und Kopfbewegungen im Wind manövrieren und dabei manchmal in der Luft zu stehen scheinen; ein Schwenk lenkt den Blick auf den Boden, auf eine der größten Brutkolonien der Vögel, wo sie auf ihren Eiern sitzen. Zu hören sind dazu nur die Rufe der Albatrosse. Es ist einer der wenigen ruhigen Momente des Films und einer der schönsten dazu, denn anschließend kommt das wieder, was schon vorher da war und bis zum Ende von "Deep Blue" nicht mehr aufhören wird: die Musik. Womit auch alle Verweise erledigt sind.
Mit Perrins "Nomaden" hat der Film danach nichts mehr zu tun. Waren es bei Perrin die Flügelgeräusche und Rufe der Vögel selbst, die den Ton zu den Bildern lieferten, ist es in "Deep Blue" das nachträglich eingespielte Werk eines Filmkomponisten. George Fenton, ausgewiesen durch die Soundtracks zu "Gandhi" und "Cry Freedom" und fünffach oscarnominiert - was keine Pressemitteilung des Verleihs zu erwähnen vergißt -, hat die Musik zu den laufenden Bildern geschrieben und mit den Berliner Philharmonikern eingespielt. Und Fenton kennt sich aus in der Geschichte der Wassermusik. Er scheut auch die leichte Muse nicht: Wenn eine Krabbe am Strand ihre Eier in den Sand legt und der Zeitraffer Eier und schlüpfende Junge zu einem rötlichen Gewirr werden läßt, schlägt er swingende Salsatöne an. Man will dann irgendwie sofort weg, ans Meer und Möwen und schlagende Wellen hören. Es gelingt aber nicht richtig, weil man die Orchestertöne nicht los wird und weil sie einem andauernd im Bild herumfuchteln.
Dabei machen die Bilder fast alles richtig. Die in jeder Kinovorschau erwähnte Jagd von Schwertwalen auf ein Grauwalbaby zum Beispiel ist überhaupt nicht sensationell blutrünstig von den Kameras eingefangen. Sieht man einmal davon ab, daß man ein Grauwaljunges so nah in solchen Aufnahmen noch nie zu Gesicht bekam, ist die Verfolgungs- und Jagdsequenz sehr ruhig gefilmt. Was auch daran liegt, daß die Kamera während der entscheidenden Phasen über Wasser bleibt und die letztlich tödlichen Bisse gegen den Jungen nicht zeigt.
Wieviel Zeit des Abwartens und Beobachtens in solchen Sequenzen steckt, unterschlägt der Film trotz seiner kurzweiligen Bildschnitte nie. Ein mit seinem Jungen über die Eiswüsten ziehender dünner Eisbär macht die Dauer anschaulich. Weit und breit nichts, keine junge Robbe im Eis, nur ein Loch, in dem weiße Wale nach Luft schnappen. Für den Bären sind sie aber zu groß, sein Jagdversuch bleibt ohne Erfolg. Wenn der Blick dann unter das Loch ins Wasser geht, wird auch klar, was der Film vielleicht mal sein wollte: eine Utopie, die auf den Grund der Erde weist. Der spärlich gesprochene Kommentar sagt irgendwann, daß bisher mehr Menschen auf dem Mond gewesen seien als in den Tiefen des Meeres. Das wird, denkt man sich, an den Druckverhältnissen da unten in fünftausend Meter Tiefe liegen. Der Anblick der kirchturmhohen Steinschlote, die vierhundert Grad heißen dunklen Schwefelwasserstoff ausspucken und um die Brühe ohne Sonne eines der artenreichsten Biotope der Erde entfalten, ist ein gelungener Kontrast zur Einöde der Marsfotografien.
Von unten kommt sowieso, und das ist die neue Erkenntnis dieses Films, eine der größten biologischen Migrationen jede Nacht an die Wasseroberfläche, um nach Nahrung zu suchen. Das ist schon dramatisch genug, wenn man es nur sieht. Dazu benötigt man weder ein Orchester, das die vermeintliche Langeweile bekämpfen soll, noch einen Kommentar, der einem die Artenvielfalt am Meeresgrund erläutert. Die ist nämlich sowieso noch weitgehend unbekannt und nur von dickgepanzerten U-Booten aus zu beobachten, in die von draußen nichts als Stille dringt.
Der Schriftsteller Franz Jung, dessen Lebensbericht "Der Weg nach unten" dieselbe Richtung einschlägt wie die Tiefsee-U-Boote im Film, hatte ein Problem mit Musik. Alles - Geburt, Leben, Tod, Haß, Liebe, Krieg und Frieden - sei inzwischen in Töne gebettet, schrieb Jung. Er fand das unerträglich; ein einfaches Geräusch war ihm lieber. Was Jung damit anprangern wollte, versteht man sofort, wenn man "Deep Blue" im Kino gesehen hat - und freut sich auf die DVD. Dann kann man den Ton abdrehen und sich den Bildern mit einem Glas Leitungswasser hingeben.
CORD RIECHELMANN
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

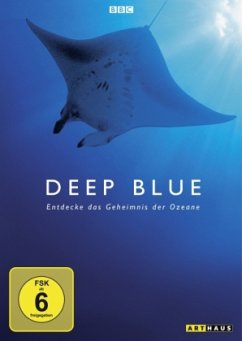


 FSK: Freigegeben ab 6 Jahren gemäß §14 JuSchG
FSK: Freigegeben ab 6 Jahren gemäß §14 JuSchG