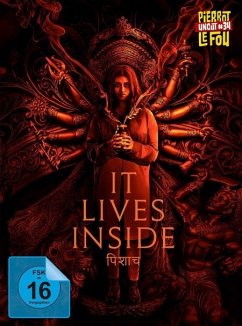Der Exorzismus von Emily Rose
The Exorcism of Emily Rose
Regie: Scott Derrickson; Mit Laura Linney, Tom Wilkinson, Campbell Scott u. a.
Versandfertig in ca. 2 Wochen
14,99 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
7 °P sammeln!
In einem außergewöhnlichen Entschluss erkennt die katholische Kirche die satanische Besessenheit der 19jährigen Studentin Emily Rose (Jennifer Carpenter) offiziell an. Pfarrer Moore (Tom Wilkinson) führt die umstrittene Teufelsaustreibung durch. Ein Unterfangen mit tödlichem Ausgang. Der Geistliche wird wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Seine Anwältin Erin Bruner (Laura Linney), mit ihrem eigenen Leben nicht zufrieden und von Einsamkeit geplagt, übernimmt die Verteidigung des Priesters. Ein Prozess, der zur Hetzjagd aller Beteiligten wird ...

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.