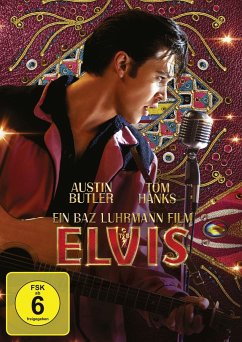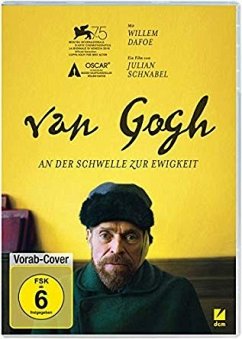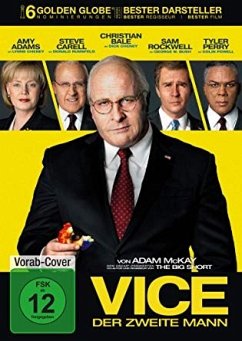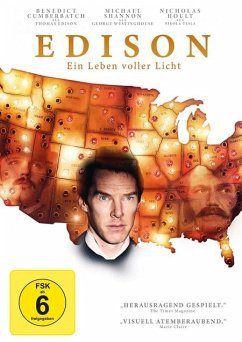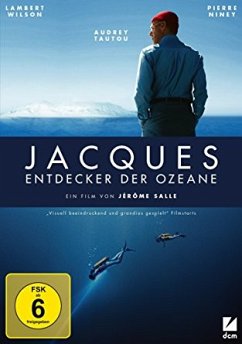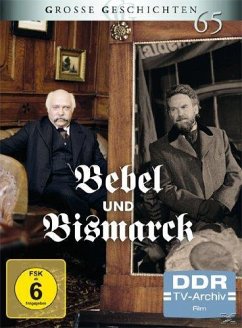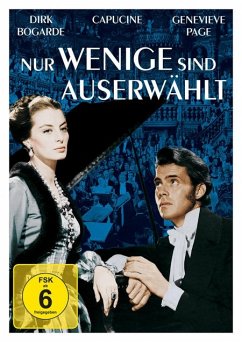Der junge Karl Marx
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 3-5 Tagen
10,99 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
5 °P sammeln!
Paris, 1844, am Vorabend der industriellen Revolution: der 26-jährige Karl Marx (August Diehl) lebt mit seiner Frau Jenny (Vicky Krieps) im französischen Exil. Als Marx dort dem jungen Friedrich Engels (Stefan Konarske) vorgestellt wird, hat der notorisch bankrotte Familienvater für den gestriegelten Bourgeois und Sohn eines Fabrikbesitzers nur Verachtung übrig. Doch der Dandy Engels hat gerade über die Verelendung des englischen Proletariats geschrieben, er liebt Mary Burns, eine Baumwollspinnerin und Rebellin der englischen Arbeiterbewegung. Engels weiß, wovon er spricht. Er ist das le...
Paris, 1844, am Vorabend der industriellen Revolution: der 26-jährige Karl Marx (August Diehl) lebt mit seiner Frau Jenny (Vicky Krieps) im französischen Exil. Als Marx dort dem jungen Friedrich Engels (Stefan Konarske) vorgestellt wird, hat der notorisch bankrotte Familienvater für den gestriegelten Bourgeois und Sohn eines Fabrikbesitzers nur Verachtung übrig. Doch der Dandy Engels hat gerade über die Verelendung des englischen Proletariats geschrieben, er liebt Mary Burns, eine Baumwollspinnerin und Rebellin der englischen Arbeiterbewegung. Engels weiß, wovon er spricht. Er ist das letzte Puzzlestück, das Marx zu einer rückhaltlosen Beschreibung der Krise noch fehlt. Marx und Engels haben denselben Humor und ein gemeinsames Ziel. Sie respektieren und inspirieren sich als Kampfgefährten - und sie können sich hervorragend miteinander betrinken. Zusammen mit Jenny Marx erarbeiten sie Schriften, die die Revolution entzünden sollen.