Amazonas, Anfang des 20. Jahrhunderts: der Schamane Karamakate wird gebeten, den deutschen Forscher Theodor Koch-Grünberg zu heilen. Doch dafür müssen sie die geheimnisvolle Yakruna-Pflanze finden. Etwa 30 Jahre später sucht der Botaniker Richard Evans Schultes Karamakate auf. Auch er ist auf der Suche nach der Yakruna. Karamakate, der mittlerweile den Zugang zur Geisterwelt verloren hat, macht sich noch einmal auf den Weg auf dem Amazonas, ins Herz der Finsternis ...

Geschichten von größeren und von kleineren Gruppen: Eine dänische Wohngemeinschaft in den siebziger Jahren, sechs griechische Männer in Dauerkonkurrenz an Bord einer Yacht und zwei Forschungsreisende im Dschungel des Amazonas auf der Suche nach einer Wunderpflanze
Manche Sätze scheinen sich durch häufigen Gebrauch von selbst zu verstehen. Wenn wir ins Kino gehen, so fängt ein solcher Satz an, wollen wir uns mit der Heldin oder dem Helden identifizieren. Aber stimmt das überhaupt so? Müssen wir mit den Guten fiebern, wollen wir die Bösen bestraft sehen? Gibt es nur diese Dramaturgie, die es anderswo, im Leben zum Beispiel, gar nicht gibt? Ist es nicht oft spannender, einer Gruppe von Menschen zuzuschauen, ohne sofort und unwiderruflich seine Sympathien zu verteilen? Überrascht zu werden, angenehm wie unangenehm? Zu spüren, wie Vorlieben dahinschwinden, und sich irgendwann, wenn eine Geschichte gut erzählt ist, gar nicht mehr entscheiden oder Partei ergreifen müssen? Weil es doch völlig reicht, wenn nur genügend Spannungen und Intensitäten zwischen den Handelnden entstehen.
Thomas Vinterberg, der 1999 durch den Dogma-Film "Das Fest" international bekannt wurde, setzt in seinem neuen Film auf diesen dramaturgischen Effekt, und "Die Kommune" ist dann auch ein gutes Beispiel geworden für die Potentiale und Probleme dieses Verfahrens. Alles beginnt in einem schönen Vorort von Kopenhagen, in einem Klima des Aufbruchs, Anfang der siebziger Jahre. Erik (Ulrich Thomsen), der Architekturdozent, hat eine große alte Villa geerbt, seine Frau Anna (Trine Dyrholm), eine beliebte Nachrichtensprecherin, überredet ihn, dort einzuziehen und eine Kommune zu gründen, bevor es in der eigenen Kleinfamilie mit heranwachsender Tochter zu öde wird.
Sie suchen sich ihre Mitbewohner, und es sieht alles gar nicht so wild aus, eher wie eine Wohngemeinschaft, welche aus Versehen die Studentenzeit überdauert hat. Keine freie Liebe oder Plädoyers für urkommunistisches Wirtschaften, nur die kleinen Rituale des Gemeinschaftslebens und die üblichen Reibereien um Einkauf, Abwasch und Zahlungsmoral. Und gelegentlich glaubt Erik, als Gründer auch mal ein bisschen herumbrüllen zu dürfen.
Natürlich muss dieser Zustand kippen, und es ist auch nicht weiter überraschend, dass Erik sich in eine Studentin verliebt und mehrheitlich durchsetzt, dass diese Emma (gespielt von Vinterbergs Frau Helene Reingaard Neumann) in das Haus einzieht. Anna ist einverstanden, und das ist der Beginn einer Selbstüberforderung, des Scheiterns an den eigenen Wünschen; dieser Moment, in dem in einer Paarbeziehung einer die offene Beziehung proklamiert und der andere vor allem deshalb zustimmt, weil er nicht als spießig gelten möchte. Aus einer solchen Kollision der Über-Ich-Normen geht selten eine brauchbare Lösung hervor. Zugleich verschiebt sich damit der Fokus des Erzählens stärker auf Anna.
Die Molltöne lassen sich nun nicht mehr vertreiben, der kleine Junge des zweiten Paares, der Fremde immer mit dem stoisch vorgetragenen Satz geschockt hatte, er werde nicht mal neun Jahre alt werden, stirbt deutlich vor seinem neunten Geburtstag, und Anna gerät auch beruflich ins Schlingern. Vinterberg, der in Gesprächen erzählt hat, dass er zwar in einer Kommune aufgewachsen, sein Film deshalb aber nicht autobiographisch sei, lässt keinerlei Neigung erkennen, mit dem alternativen Lebensentwurf abzurechnen oder ihn lächerlich erscheinen zu lassen. Er strahlt eine Gelassenheit aus, die man sich mit 46 Jahren auch gönnen kann; womöglich waren seine Erfahrungen gar nicht so traumatisch, dass ein rabiater Befreiungsschlag nötig gewesen wäre.
Er schaut der Gruppe zu, ihren Interaktionen und Reaktionen, er lässt keine eindeutigen Sympathien erkennen, niemand wird bevorzugt dargestellt oder moralisch verurteilt; er setzt lediglich Akzente, indem er sich stärker auf Erik und Anna konzentriert als auf die übrigen Kommunarden. Eine Haltung, die einwandfrei ist - und für einen Film leider auch ein bisschen langweilig, weil die klare Perspektivierung fehlt, weil er sich nicht entscheiden kann oder will, sei es für den Blickwinkel von Anna, sei es für den ihrer Tochter, welcher Vinterbergs eigener Erfahrung wohl am ehesten entspräche. Und gerade die Tochter verliert der Film phasenweise fast ganz aus dem Blick. Eine größere Konsequenz hätte gar nicht zwingend zur Parteinahme führen müssen, sie hätte jedoch klarer erkennen lassen, wessen Geschichte eigentlich erzählt werden soll. Denn als ein Kaleidoskop der verschiedenen Perspektiven ist "Die Kommune" ganz ersichtlich nicht angelegt.
* * *
Auch Athina Rachel Tsangari zeigt in "Chevalier" ein Ensemble, eine ganz spezielle Kommune, wenn man so will: eine Männergruppe. Sechs Griechen auf einem Boot, einer Luxusyacht. Sechs Männer, keine Frau, ein Kapitän, zwei Stewards, um genau zu sein. Sie tauchen und fischen, aber so ganz klar wird nicht, was sie verbindet. Mehr als ein paar Andeutungen und Hinweise gibt es nicht, was seinerseits ein klares Signal ist. Tsangari wird seit ihrem Film "Attenberg" (2010) zur "Greek Weird Wave" gerechnet, zur griechischen schrägen Welle, wie das amerikanische Branchenblatt "Variety" sie getauft hat.
Man sollte das nicht zu wörtlich nehmen und vor allem nicht versuchen, in den Filmen verschlüsselte Krisendiagnosen zu entziffern. Was natürlich nicht bedeutet, ein Film wie "Chevalier" könne im luftleeren Raum entstehen. Tsangari, die man auch als Schauspielerin aus Richard Linklaters "Before Midnight" kennt, hat bei ihrem Testosteronausschüttungs-Wettbewerb eine gute Mittellage anvisiert: zwischen Realismus und Versuchsanordnung, zwischen Alltag und Allegorie. Die Männer an Bord sind Individuen und nicht nur Funktionsträger, zugleich ist jeder für sich nicht interessant genug, als dass man ihn besonders deutlich konturieren müsste. Vielleicht ist Tsangaris Blick feministisch, mit Sicherheit ist der Film eine Studie über gender- und geschlechtsspezifisches Verhalten: Was tun Männer, wenn sie ganz unter sich sind? Die klare Antwort: Alles, wirklich alles, um in ständiger Konkurrenz um die lächerlichsten Kleinigkeiten herauszufinden, wer der Beste und Tollste ist und wer den Längsten hat.
Die sechs durchweg gutsituierten und von der Finanzkrise offenbar nicht gebeutelten Herren zwischen Mitte sechzig und Mitte dreißig langweilen sich an Bord ein wenig, bis einer sagt, man solle doch "Bester in allem" spielen. Jeder denkt sich eine Herausforderung aus, jeder bewertet jeden, und so laufen sie bald mit Notizbüchern herum und schreiben die Punkte auf. Eine klassische Gruppendynamik entfaltet sich, mit kurzfristigen Allianzen und Absprachen, mit Ausbrüchen von Hass und Augenblicken großer Peinlichkeit. Es gibt Slapstick-Einlagen und Karaoke, Cholesterin- und Blutzuckerwerte werden gemessen, weil einer der Männer Arzt ist, sie lassen Steine übers Wasser hüpfen, bewerten Schlafhaltung, Farbe der Unterwäsche und Stabilität der Erektion. Besonders apart auch das Bild, wenn Ikea-Regale aufgebaut werden müssen und sie hinterher wie mickrige dunkle Säulen auf dem Vorderdeck der Luxusyacht stehen.
Athina Rachel Tsangari inszeniert das sehr smart. Sie muss weder die einzelnen Wettkämpfe komplett zeigen, noch muss sie die Regeln erklären, manche Einlage ist ihr nur eine knappe, pointierte Szene wert. Die Dramaturgie des Films macht sich gerade nicht die der permanenten Konkurrenz zu eigen. So entgeht sie der atemlosen Fixierung, sie schaut amüsiert zu, statt hinterherzuhecheln, und aus diesem fragmentierenden Erzählen resultiert auch der sarkastische Witz des Films, dessen Titel sich im Übrigen dem Siegespreis verdankt, dem Chevaliers-Ring. Und sehr schön ist dabei die kleine Erinnerung an Jean Renoirs Klassiker "Die Spielregel", wenn sich die Konkurrenzmechanismen bis in die Schiffsbesatzung verlängern, so wie bei Renoir das Verhalten der feinen Bürger in dem des Personals sein Spiegelbild fand.
Es geht Tsangari auch nicht darum, alle sechs gleichmäßig zu beschreiben und allen die gleiche Aufmerksamkeit zu widmen. Sie interessiert sich für die Mechanismen und Prozesse, die wirksam werden, wenn Männer nichts Gescheites zu tun haben. Manchmal rennt sie dabei auch offene Türen ein, aber damit kann man als Mann gut leben - man könnte am Ende auch daraus noch mühelos einen Wettbewerb machen.
* * *
Wenn das Kino in den Urwald geht, fallen ziemlich reflexhaft immer Namen und Titel wie Herzogs "Aguirre" oder Coppolas "Apocalypse Now". Und jeder meint, weil es halt viele offene Türen auf der Welt gibt, dass dort nur der Blick der Eroberer und Zerstörer indigener Kulturen regiere. Der kolumbianische Regisseur Ciro Guerra, auch wenn er den Kolonialismus kritisieren will, macht es sich so einfach nicht. "Der Schamane und die Schlange" erzählt von zwei Reisen in das Amazonasgebiet, und er ist in einem zugleich distanzierenden wie verführerischen Schwarzweiß gedreht. Der Film bedient sich dabei zweier Reisetagebücher. Das eine stammt von dem deutschen Anthropologen Theodor Koch-Grünberg, der die Gegend 1909 bereiste, das zweite von dem amerikanischen Biologen Richard Evans Schultes, der in den vierziger Jahren kam. Beide treffen sie in Guerras Film auf denselben Schamanen, Karamakate, der sie zu der Wunderpflanze Yakruna führen soll.
Guerra erzählt in einem schleppenden Rhythmus, er wechselt zwischen den beiden Reisen hin und her und damit auch vom jungen, zornigen zum alten, zweifelnden Karamakate. Dieser Rhythmus hat etwas leicht Meditatives, und das liegt nicht bloß daran, dass die Reisenden unterwegs reichlich pflanzliche Drogen konsumieren. Die fatalen Folgen der Kautschukgewinnung für die Bewohner des Dschungels werden gestreift, auch die Gnadenlosigkeit der christlichen Mission, und Guerra findet den einen oder anderen Moment, in dem klar wird, warum im Handeln der Forscher gutgemeint meist das Gegenteil von gut ist. Als Theodor unbedingt seinen Kompass wiederhaben will von einem Stammeshäuptling, fordert er das nicht, weil er ihn dringend benötigte in der Wildnis, sondern weil er glaubt, mit dem Gebrauch des Kompasses werde das Wissen des Stammes verschwinden, wie man sich allein an Wind und Sternen orientiert. Was der Schamane mit den Worten kommentiert, man könne die Menschen nicht am Lernen hindern.
Doch trotz solcher Augenblicke der Klarheit, trotz der visuellen Kraft des Films will aus dieser Geschichte zweier Reisen einfach kein konsistentes Ganzes werden. Dass man ohne die Aufzeichnungen der weißen Forscher nichts mehr wüsste von den Stämmen, die von den weißen Kolonisatoren ausgelöscht wurden, mit dieser traurigen Dialektik weiß "Der Schamane und die Schlange" nicht allzu viel anzufangen. Und so stellt sich das Gefühl ein, der Film wisse am Ende weniger, was er wollte, als zu Anfang.
PETER KÖRTE
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main








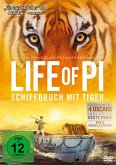
 FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG
FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG