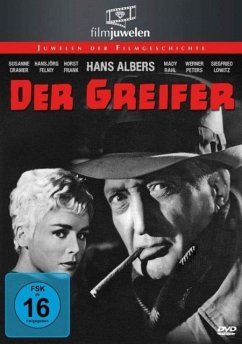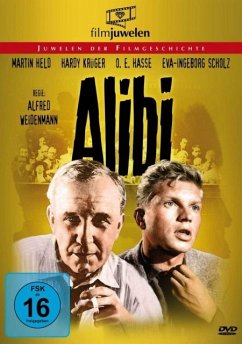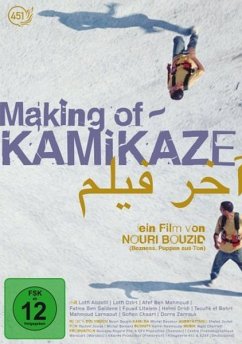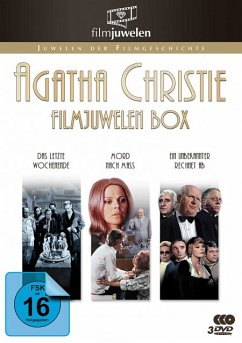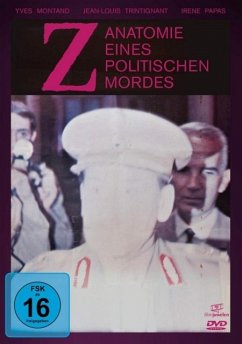Der See der wilden Gänse
Versandfertig in ca. 2 Wochen
16,99 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
8 °P sammeln!
Nach einem Zusammenstoß in Wuhan mit einer rivalisierenden Bande, bei dem er einen Polizisten getötet hat, ist der Gangster Zhou Zenong auf der Flucht. Nicht nur die Gesetzeshüter ziehen das Netz enger, sondern auch seine ehemaligen Gangmitglieder wollen an ihn herankommen und senden dafür die Prostituierte Liu Aiai als Köder aus. Wird Zenong seinen Gegnern entfliehen können?

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.