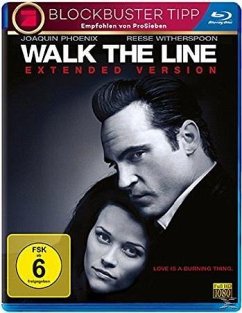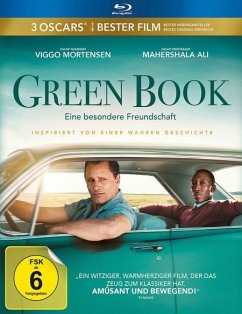Die Queen

PAYBACK Punkte
7 °P sammeln!
1. September 1997: Die Welt erwacht und Prinzessin Diana ist tot. Die wohl bekannteste Frau der Welt und Ex-Gattin des englischen Thronfolgers ist bei einem Autounfall gestorben. Die Nachricht versetzt Menschen rund um die Erde in einen Schock und schon am nächsten Tag bedeckt ein Meer von letzten Blumengrüßen an die Verstorbene den Boden vor dem Buckingham Palace. Doch der Palast steht leer. Die Royals verharren trotz der Tragödie hinter den dicken Mauern ihres schottischen Landsitzes Schloss Balmoral. In der Welt des starren Hofprotokolls sind Emotionen tabu. Die Familie wird in privater Abgeschiedenheit trauern, die beiden 13 und 15 Jahre alten Söhne der Prinzessin sollen vor der Neugier der Medien geschützt werden. Der Queen erscheint es angemessen, Dianas Tod als Privatsache zu behandeln, schließlich war sie ja nicht mehr Mitglied der königlichen Familie. Auch wenn die Queen sich samt Familie verstecken mag, für Tony Blair ist das Ereignis seine Feuertaufe als Politiker. Erst drei Monate zuvor errang er einen erdrutschartigen Wahlsieg für seine Labourpartei und er spürt, dass sich die Stimmung im Land ändert. Von Reserviertheit und Beherrschung keine Spur, statt dessen türmt sich die Woge der Gefühle zu einer wahren Sintflut auf, wie sie das Königreich noch nie zuvor erlebt hat. Diana war für alle Briten die, wie Blair sie tauft, "Prinzessin der Herzen". Als Blair ein Staatsbegräbnis für Diana vorschlägt, damit "das Volk die Trauer teilen kann", zuckt die Queen empört zusammen. Bereits am Montag der folgenden Woche watet die Palastwache durch ein knietiefes Blumenmeer vor dem Buckingham Palace. Blairs rechte Hand Alistair Campbell weidet sich schon an der Vorstellung, dass die Queen unfähig ist, die Stimmung ihres Volkes zu erkennen, während Blairs Popularität nach seinen Gesten des Mitgefühles schier ins Unermessliche steigt. Doch ausgerechnet der Premierminister fühlt Loyalität mit der Queen in sich aufsteigen, vor allem, als Prinz Charles sich von der Haltung seiner Mutter distanziert und Blair seine volle Unterstützung zusichert. Als die Queen erfahren muss, dass das Begräbnis ihrer Ex-Schwiegertochter jenem Ablaufplan gehorchen soll, der für den Tod der Queen Mum vorgesehen wurde, ist das ein Angriff auf ihre Autorität. Statt Staatsgästen und ranghoher Militärs sollen Künstler und prominente Freunde der Toten der Trauerfeier beiwohnen. Es bleibt nicht das einzige Zugeständnis an die öffentliche Trauer um Diana, das die Queen eingehen muss. Fast scheint es ihr, als ob die Prinzessin nach ihrem Tod ebenso viele Probleme wie zu Lebzeiten verursacht. Nur in Balmoral ist alles beim alten geblieben. Die Vorbereitungen für die Trauerfeier beginnen, es werden über zwei Millionen Menschen in London erwartet. Die Presse regt sich auf, dass am Buckingham Palace keine Fahne auf Halbmast zu sehen ist: "Zeigt uns, dass das Haus Windsor ein Herz besitzt!". Blair schlägt vor, trotz Abwesenheit der Königin und entgegen dem Protokoll die Fahne auf Halbmast wehen zu lassen. Er erntet damit keinen Beifall bei der Queen, die langsam frustriert ist von den Ratschlägen des Jungspund-Premiers. In Anbetracht der Lage fordert Tony Blair die Queen noch einmal auf, nach London zu kommen, um mit dem Volk "seine Trauer zu teilen". So langsam dämmert es der Queen, dass sie die Volksseele nicht mehr versteht ...

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.