Für Tony läufts mal wieder alles andere als rund. Hin- und hergerissen zwischen den Ansprüchen der einen Familie - Gattin Carmel, Tochter Meadow und Sohn Anthony Jr. - und den Anforderungen seiner anderen Familie - Paulie Walnuts, Silvio Dante und Big Pussy Bompensiero - muss er einen Balanceakt hinlegen, der eines waschechten Mafia-Bosses unwürdig ist. Alssich seine eigene Mutter und der Onkel gegen ihn verschwören, SchwesterJanice ihr eigenes Chaos versursacht und jemand in seinem nächsten Umfeld ein mutmaßlicher Maulwurf fürs FBI ist, braucht er die Hilfe seiner Psychiaterin mehr denn je.
Bonusmaterial
DVD-Ausstattung / Bonusmaterial: - Kapitel- / Szenenanwahl - Animiertes DVD-Menü
Folgen hatte die Serie "The Sopranos" viele. "The Many Saints of Newark" bringt die Vorgeschichte ins Kino.
Friedhöfe sind ihrer Bestimmung nach stille Orte. Doch wer genau hinhört oder wer eine rege Vorstellungskraft hat, hört vielleicht ein Gemurmel, das sich von Grabstein zu Grabstein fortpflanzt. Das große Epos der unerzählten Geschichten hebt hier an, denn die Toten haben noch etwas mitzuteilen. In Alan Taylors Film "The Many Saints of Newark" schnappen wir zu Beginn ein paar Fetzen von Lebenszeugnissen auf, bei denen man sich auch für eine Fortsetzung interessieren könnte.
Richtig spannend aber wird es bei einem Grab, das einen bekannten Namen trägt: Christopher Moltisanti (1969 bis 2007). Geläufig ist er aus einer der größten Fernsehserien der neueren Zeit. In "The Sopranos" war Christopher der "Neffe" der zentralen Figur Tony Soprano, eines Mafiapaten in New Jersey. Das Wort "nephew" war bei Christopher weniger ein Ausdruck für Abstammung als für Erwählung. Er hatte, wäre er dafür besser geeignet gewesen, Chancen auf eine Thronfolge. Stattdessen fand er einen frühen Tod, wie es auch für alle, die nie zugeschaut haben oder sich nicht mehr so gut erinnern, in "The Many Saints of Newark" gleich klipp und klar ausgesprochen wird. Der Blick fällt auf einen nicht ganz schmalen Jungen, und aus dem Grab erfolgt die halb liebevolle Vorstellung: "the little fat kid is my uncle". Antonio "Tony" Soprano anno 1967. "Er hat mich umgebracht, aber das war viel später."
Was in dieser Welt später kam, war für das weltweite Publikum früher. Dem Genuss, der daraus entsteht, widmet sich "The Many Saints of Newark", ein Prequel, also eine Fortsetzung, die eine Vorsetzung ist. David Chase, der Erfinder der Sopranos, hat das Drehbuch geschrieben, mit Lawrence Konner, der auch bei der Gangstersaga "Boardwalk Empire" beteiligt war. "The Sopranos" liefen ab 1999 über sechs Staffeln mit 86 Folgen. Entsprechend groß und detailreich ist ihr Universum: originelle Figuren wie Paulie "Walnuts" Gualtieri, vielschichtige Frauen wie Tonys ältere Schwester Janice, weitschweifige Racheplots oder auch bürgerliche Ambitionen. Für "The Many Saints of Newark" ist dieses Universum der ständige Bezugspunkt, es muss ja alles darauf zulaufen, ohne sich in schlechter Linearität zu erschöpfen. Der erste kluge Schachzug besteht schon darin, dass die Moltisantis im Zentrum stehen, während die Sopranos von der Seite betrachtet werden. Der Titel des Films macht das gleich deutlich: De Moltisantis sind die "vielen Heiligen", in einer wörtlichen Übersetzung des italienischen Namens. Das durch und durch ödipale Prinzip des Generationsromans steht am Anfang: Richard "Dickie" Moltisanti (Alessandro Nivola) holt seinen Vater am Hafen ab. Dieser kommt mit seiner jungen Braut Giuseppina aus Italien, er will eine zweite Familie gründen, mit Kindern, die dann so alt wären wie die von Dickie, der mit seiner Frau Joanne allerdings keine hat. Stattdessen ist er gut mit dem kleinen Antonio, der nach einer Autorität außerhalb der Familie sucht, denn sein Vater Junior ist eine lächerliche Figur.
Dass in einem anderen Teil Amerikas 1967 gerade ein "summer of love" im Gange ist, wird gesprächsweise erwähnt. In Newark allerdings stehen andere Angelegenheiten im Mittelpunkt. David Chase hat den Film um Unruhen herumgebaut, die ein wichtiges historisches Datum dieses bewegten Jahres sind. Zur italoamerikanischen Perspektive kommt so eine afroamerikanische, und Dickie Moltisanti bekommt einen Partner und Gegenspieler aus der Bevölkerungsgruppe, für die damals das Wort "Farbige" ("coloreds") noch eine der gemäßigteren Bezeichnungen war. Harold (Leslie Odom Jr.) hat anfangs nur eine nachrangige Funktion im "numbers game", der illegalen Lotterie der Mafia. Er schickt sich aber bald an, auf eigene Faust zu operieren; die Folge ist ein Bandenkrieg, der im Hintergrund mitläuft.
Denn "Die Sopranos" sind nun einmal vor allem Charakterdrama, die Evolution des organisierten Verbrechens an der Ostküste ist Männersache, der Serie und nun auch dem Film aber geht es auch um die Frauen. Und um spezifische Kultur, zum Beispiel beim Verständnis psychischer Probleme, für die es in Amerika in den sechziger Jahren aber zunehmend Medikamente gibt. So findet sich der Teenager Antonio eines Tages in einem Gespräch mit seiner Mutter über das Undenkbare: er versucht, ihr ein Psychopharmakon plausibel zu machen. Dieses Elavil spielt in der großartigen Schlusspointe noch einmal eine Rolle.
Wir sind mit diesen Begebenheiten in etwa dort, wo auch die Serie "Mad Men" an einer Vorgeschichte der Gegenwart gearbeitet hat. Die Sopranos sind als Mythos längst stark genug, um sich von Vorbildern nicht beeindrucken zu lassen; so kann die Familie (in dem Jahr, in dem Coppolas "The Godfather" in die Kinos kam) fernsehend vor einem schwarzweißen Klassiker mit Humphrey Bogart und Edward G. Robinson sitzen. Chase und Konners unterlaufen in diesem Moment geschickt den Konkurrenzdruck durch die kanonische Mafia-Saga und machen einmal mehr deutlich, dass die Sopranos das große Kino mit einer Alltagsgeschichte verbinden.
Die Serie endete mit einem Wimpernschlag zwischen einem ganz normalen Abendessen und dem Dunkel des Nichts. Etwaige Fortsetzungen waren obsolet, weil man dieses geniale Manöver damit entwertet hätte. 2013 starb der Hauptdarsteller James Gandolfini. Es ist nun sein eigener Sohn Michael, der den jungen Antonio spielt, eine weitere Verschränkung der Zeiten in "The Many Saints of Newark". Tony Soprano hatte einen Sohn, A.J., der sich für das Amt eines Paten wenig geeignet zeigte. Er knallte sich lieber mit harter Musik die Ohren voll. Wenn der halbwüchsige Antonio sich nun zu einem Song der Band Mountain zwischen zwei Boxen legt und die volle Dröhnung nimmt, ist das einer von vielen Aspekten in einem Traditionsprozess, der sich zwischen väterlichem Gesetz und popkultureller Emanzipation vollzieht. Beinahe könnte man sich wünschen, mit Michael Gandolfini die ganze Geschichte von Tony Soprano noch einmal erzählt zu bekommen - als Paralleluniversum, aus dem Geist der Suggestion des neueren Serienfernsehens, dass es zu jedem schicksalhaften Moment auch einen gibt, der Druck aus dem Determinismus nimmt. Manche halten "The Many Saints of Newark" für Geschäftemacherei. Es ist aber ein bedeutender Baustein eines amerikanischen Monuments. BERT REBHANDL
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

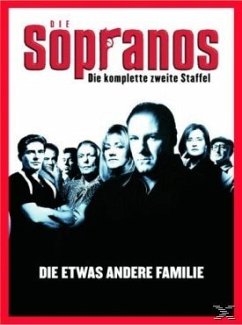
 FSK: ohne Alterseinschränkung gemäß §14 JuSchG
FSK: ohne Alterseinschränkung gemäß §14 JuSchG