Die schöne Julie (Romy Schneider) lebt mit ihrem bedeutend älteren Mann Louis (Rod Steiger) in einer luxuriösen Villa in St. Tropez. Doch sie hat ihn und seine zynische Art satt und so schmiedet sie mit ihrem jungen Liebhaber Jeff (Paolo Giusti) einen perfiden Mordkomplott: Sie will Louis beseitigen und mit dessen Vermögen ein neues Leben beginnen. Es soll aussehen wie ein Unfall, doch der Plan geht schief. Plötzlich taucht der Totgesagte wieder auf...
Bonusmaterial
DVD-Ausstattung / Bonusmaterial: - Bio- und Filmografien - Trailer
Mit Jessica Schwarz in der Hauptrolle hat die ARD das Leben von Romy Schneider verfilmt. Man kann sich fragen, warum
Ein kleines Haarbürzel haben sie Jessica Schwarz oben an die Stirn geklebt, um die Ähnlichkeit zu Romy Schneider zu erhöhen. Die hatte nämlich erstens eine sehr hohe Stirn und zweitens einen Haaransatz, der ein kleines bisschen in die Stirn hineinragte, das also hat man Jessica Schwarz als Maske mitgegeben, ansonsten war sie auf sich alleine gestellt. Warum, fragt man sich, der Aufwand mit dem Bürzel? Was ist mit der Nase? Dem Hals? Dem Gang? Und der Stimme? Diese unverwechselbare Romy-Schneider-Stimme, der etwas so mädchenhaft Unschuldiges innewohnte, bis der französische Regisseur Claude Sautet ihr riet, doch etwas tiefer zu sprechen. Jessica Schwarz' Stimme ist dunkel und rauchig, und bis auf eine leicht österreichisch angehauchte Färbung versucht sie auch gar nicht erst, wie Romy Schneider zu sprechen. Was wohl das Klügste ist, was diese Schauspielerin tun konnte, die seit ihren Filmen mit Dominik Graf zu Recht zu den besten unseres Landes zählt. Aber ob es so klug war, diesen Film überhaupt zu drehen?
Es dauert etwa achtzig Minuten, bis man die Überraschung überwunden hat, Jessica Schwarz in allen möglichen Situationen zu sehen, die man eher Romy Schneider zugeordnet hätte. Ach, sieh an, denkt man, Jessica Schwarz war auch mit Alain Delon zusammen? Ach, guck mal, Jessica Schwarz hat auch unter Visconti Theater gespielt? Darunter gelitten, in Deutschland immer nur als "Sissi" wahrgenommen zu werden? Den Schauspieler Wolf Albach-Retty zum Vater gehabt? Man sieht einen Film über das Leben von Romy Schneider und kann weit über die Hälfte keine Sekunde lang vergessen, dass man hier Jessica Schwarz vor sich sieht, Haarbürzel hin oder her. Das ist ein Problem. Es ist ein Problem, das alle Filme haben, die das Leben berühmter Filmschauspieler zum Thema haben: Man kennt das Vorbild vom selben Medium, von bewegten Bildern - das ist so, als würde der Geiger Nikolaj Znaider plötzlich eine Platte veröffentlichen, auf der er so zu spielen versucht wie Yehudi Menuhin.
Hinzu kommt, dass die Biographien berühmter Schauspieler meistens so hinreichend bekannt sind, dass ein Film nur den wenigsten noch irgendetwas Neues erzählen kann. Wer hätte etwa noch nie gehört, dass Romy Schneider ihr Leben lang darunter litt, in Deutschland nicht als ernsthafte Schauspielerin wahrgenommen zu werden und gute, erwachsene Rollen nur in Frankreich spielen zu dürfen? Wer wüsste nicht von den tragischen Schicksalsschlägen ihres Lebens: von ihrem Selbstmordversuch, nachdem Alain Delon sie verließ; vom Selbstmord ihres geschiedenen Mannes, Harry Meyen; vom tragischen Tod ihres gemeinsamen Sohnes David, der beim Versuch, über einen Zaun zu klettern, stürzte und ums Leben kam. Auch dass sich Paparazzi als Krankenpfleger verkleidet Zugang in das Krankenhaus verschafften und den toten Sohn fotografierten, ist bekannt. All das erzählt der Film "Romy" nun in schönen Bildern noch einmal nach.
Warum?
Jedes Jahr erscheint mindestens ein neuer Bildband mit angeblich privaten Fotografien, auf denen man Romy Schneider mit ihren Kindern spielen sehen kann. Oder nackt. Oder angezogen. Oder traurig. Oder ausgelassen. Oder mit Ballonmütze. Oder ohne. Bestimmt tausend Mal haben wir ihre handschriftlichen Zeugnisse rotweingeschwängerter Nächte irgendwo abgedruckt gesehen, Zettelchen und Briefe, die sie in die ganze Welt verschickte, aus denen ein ungeheurer Lebenshunger spricht und die verzweifelte Sehnsucht danach, ernst genommen und verstanden zu werden. Na gut, man kann es auch so sehen, ein Film über sie schadet da auch nicht weiter, ein Glück nur, dass es nicht zwei wurden, es war ja auch ein Projekt mit Yvonne Catterfeld geplant, das dann aus irgendwelchen Gründen nicht zustande kam.
Aber Filmbiographien haben noch ein weiteres Problem: Die meisten nehmen sich eine sehr lange Zeitspanne aus dem Leben ihrer Protagonisten vor, weshalb die Handlung dann oft wirkt wie ein Abhaken von Wikipedia-Einträgen. Und dann war das und dann das, und dann kam noch das. Auch "Romy" (Regie: Torsten C. Fischer) erzählt im Grunde das ganze Leben von Romy Schneider nach, das Meiste im Rückblick, der aber reicht bis ins Kindesalter zurück. Da sieht man dann eine andere, jüngere Schauspielerin (die weder Schneider noch Schwarz auch nur im Entferntesten ähnelt) mit roten Backen durch das Berchtesgadener Voralpenland toben; wieder eine andere, etwas ältere, die wieder ganz anders aussieht, spielt Schneider von der Internats- bis zur "Sissi"-Zeit; ab der Paris-Zeit übernimmt dann Jessica Schwarz, die wir eingangs schon als erwachsene Romy in einem Pariser Krankenhaus gesehen haben, wo ihr gerade eine Niere herausoperiert wurde, das war, kurz bevor ihr Sohn starb, und ein Jahr vor ihrem eigenen Tod.
Die stärksten Szenen des Films sind dann auch die, die sich etwas Zeit lassen mit dem, was sie erzählen wollen. Das ist vor allem die Geschichte ihrer Ehe mit dem Schauspieler und Dramatiker Harry Meyen, mit dem sie von 1966 bis 1973 verheiratet war und in West-Berlin lebte. Thomas Kretschmann als Harry Meyen ist die große Überraschung des Films: Er spielt den sich verkannt fühlenden Intellektuellen, der es nicht verwinden kann, mit einer Frau verheiratet zu sein, die so viel berühmter ist als er, mit zurückgenommenen Gesten und eisiger Präzision.
In einer Szene, die im Hause Schneider-Meyen spielt, gibt es dann auch den ersten Moment, an dem man Jessica Schwarz die Romy Schneider abnimmt. Allerdings ist sie darin nur von hinten zu sehen, in einem am Rücken tief ausgeschnittenen Abendkleid, ein Kind auf dem Arm. Als sie sich dann umdreht, ist es dann aber doch wieder nur Jessica Schwarz. Vielleicht ist Romy Schneider einfach zu überlebensgroß in unseren Köpfen eingebrannt - vielleicht war sie zu einzigartig in ihrer Mischung aus unbekümmertem Charme und erwachsener Tiefe. Vielleicht wäre die Transferleistung, die beim Zuschauer erforderlich ist, für keine Schauspielerin der Welt zu erreichen gewesen. Oder vielleicht wäre eine Schauspielerin, die weniger omnipräsent in der "Bunten" wäre, weniger selbst ein Star, hilfreicher gewesen. So wirkt das ganze Projekt wie ein sportlicher Wettbewerb: Wird es der bekannten Schauspielerin Jessica Schwarz gelingen, sich in Romy Schneider zu verwandeln?
Nein, es gelingt nicht, und die Verantwortlichen des Films sagen auch, das sei gar nicht die Absicht gewesen. Sie hätten eine Annäherung schaffen wollen, eine Interpretation, keine Imitation. Leider ist es keine Annäherung an das geworden, was Romy Schneider so besonders gemacht hat. Trotz liebevoller Ausstattung und genauer Recherche. Und das liegt nicht an der Hauptdarstellerin, die es besser nicht hätte spielen können - es liegt einfach an Romy Schneider, deren Geheimnis wohl eher ihre Ausstrahlung war und nicht die Umstände ihres Lebens.
Kurz vor Schluss, endlich, ist man als Zuschauer bereit, sich für Momente auf die Behauptung einzulassen, dass sie es ist, die hier gezeigt werden soll. Aber bis dahin sind beinahe eineinhalb Stunden vergangen, in denen man nur eine Schauspielerin in deren Kleidern gesehen hat, in ihren Chanelkostümen aus Paris, im schwarzen Bikini aus "Swimming Pool", mit der großen Lesebrille aus "Die Dinge des Lebens".
Und die ARD macht es ihrer Hauptdarstellerin auch wirklich nicht leicht. In direktem Anschluss zeigt sie eine halbstündige Dokumentation, in der Romy Schneider selbst zu Wort kommt. Und da ist er wieder zu erleben, dieser Zauber, der von ihr ausging und der einen so direkt ins Herz trifft. Immer noch, unerreicht, unerreichbar.
JOHANNA ADORJÁN
"Romy": am Mittwoch, 20.15 Uhr, ARD. Im direkten Anschluss um 22 Uhr die Dokumentation: "Romy - eine Nahaufnahme"
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main


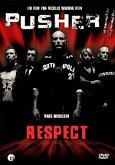





 FSK: Freigegeben ab 16 Jahren gemäß §14 JuSchG
FSK: Freigegeben ab 16 Jahren gemäß §14 JuSchG