Kurz vor dem zweiten Weltkrieg: Der Offizier Louis (Daniel Auteuil) und die wunderschöne Jeanne (Emmanuelle Béart) verlieben sich und heiraten. Doch bald schon wird Louis eingezogen und kehrt erst nach 5 Jahren von der Front zurück. Jeanne konnte ihm nicht die Treue halten; dennoch bleibt Louis bei ihr und sie gehen gemeinsam nach Berlin. Doch das Glück ist von kurzer Dauer, denn Jeanne beginnt eine leidenschaftliche Affäre mit dem jungen deutschen Offizier Mathias (Gabriel Barylli), der Jeanne unbedingt heiraten will. Es kommt zur Auseinandersetzung zwischen Louis und dem Liebhaber und die Situation steuert zwangsläufig in die Katastrophe...
Bonusmaterial
DVD-Ausstattung / Bonusmaterial: - Kapitel- / Szenenanwahl
Im Kino: "Eine französische Frau" mit Emmanuelle Béart
"Schwache Meister suchen von der Schönheit des Objekts zu profitieren", schrieb der Berliner Kunsthistoriker Max J. Friedländer vor gut fünfzig Jahren, ohne ahnen zu können, wie genau das Bonmot für den Film "Eine französische Frau" zutreffen würde. Ein Titel, der Charme und Chanel, Lockung und Leidenschaft verspricht. Das Plakat: hinreißend. Ein üppiger, aufgeworfener Mund, der kühnste Wünsche weckt, eine dunkle Schildpattbrille, Mondänität und Geheimnis verheißend. Schließlich der Film: schwach.
Emmanuelle Béart spielt diese französische Frau, und sie ist in der Tat sehr schön. Ein wenig zu schön vielleicht. Denn was nicht unmerklich entstellt ist, wirkt kühl und empfindungslos, befand schon Baudelaire. Das Unregelmäßige, die Überraschung, das Erstaunen stellt ein wesentliches Merkmal des Schönen dar.
Nichts davon läßt sich im vierten Spielfilm des Regisseurs Régis Wargnier entdecken. Zum Erstaunlichsten zählt noch, daß seine Protagonisten am Ende der fast zwei Jahrzehnte überspannenden Geschichte genauso aussehen wie am ersten Tag. Erzählt wird das Leben einer unglücklichen und unzufriedenen Soldatenfrau, einer Art Madame Bovary der Garnisonsstadt. Der zurückblickende Erzähler aus dem Off ist ihr mittlerweile erwachsener Sohn. Im Sommer 1939 heiratet die schöne Jeanne den feschen Offizier Louis (Daniel Auteuil). Das Glück währt kurz, der Krieg bricht aus. Jeanne wartet auf die Rückkehr ihres Mannes, aber sie ist ihm nicht treu. Als ein Geschlagener - wenngleich in tadelloser Uniform - kommt er 1944 zurück: "Ich bin ein Feigling, du bist eine Nutte." Die kleine Familie wird nach Berlin versetzt. Siegreich marschieren die Franzosen durch die städtische Trümmerlandschaft. Man wohnt großbürgerlich in einer beschlagnahmten Villa, genießt das glanzvolle Nachtleben im Casino. Jeanne trifft die große Liebe ihres Lebens, einen jungen Deutschen (Gabriel Barylli). 1948 wird Louis nach Indochina beordert. Jeanne darbt in Frankreich, zerrissen zwischen Mutterpflicht und Liebesglück, zwischen Familienbande und persönlicher Erfüllung. Louis wird Militärattaché in Damaskus - für die Gemahlin bietet sich Gelegenheit, in großer Garderobe vor antiken Tempeln zu flanieren. Der Geliebte bleibt hartnäckig, mit Jeanne will er leben. Beim finalen Kampf der beiden Männer verletzt Jeanne ihren Ehemann so schwer, daß sie ihn jetzt niemals wird verlassen können.
Das Zeichen der Gewalt schweißt sie unlösbar aneinander, auch wenn Louis, kaum genesen, als Freiwilliger nach Indochina zurückkehrt. Ein paar Jahre später wird er nach Algerien gehen. "Jeanne hatte andere Liebhaber, Louis zog in andere Kriege", resümiert die Stimme aus dem Off die schlechte Nummernregie des Films. Wo Krieg an Krieg und Mann an Mann sich reiht, verkommt der einzelne zur Bedeutungslosigkeit.
Eine unbeholfene Stationendramaturgie hakt Episode um Episode ab. Zwischentitel markieren überdeutlich die Zeitachse, als ahne der Film, daß von einer inneren Entwicklung der Charaktere, von sich verändernden Zeitstimmungen der französischen Nachkriegsgesellschaft nichts zu sehen ist. Hier treffen sich Probleme der Regie mit denen der Schauspieler. Daniel Auteuil, eigentlich ein erfahrener und bewährter Charakterdarsteller, steht meist ein wenig ratlos vor der Kamera. Seiner Figur fehlt die Richtung, die Zuspitzung. Die Kriege übersteht er unversehrt, es sind die Szenen einer Ehe, die tiefe Blessuren hinterlassen.
Der Kolonialkrieg als Flucht vor dem Kampf daheim? Ist der Mann ein Held oder ein Feigling? Läßt ihn Masochismus oder Toleranz die Liebhaber seiner Frau ertragen? Liebt er zu stark oder zu schwach, wenn er sie immer wieder mit den Kindern zurückläßt in Frankreich? Gerne hätten wir Anhaltspunkte, aber wir erhalten sie nicht.
Gabriel Barylli spielt einen politisch korrekten, guten Deutschen mit großen Augen und verhaltener Intensität; in einem ungemein thesenartigen Vortrag wirft er seinem Vater vor, daß er hätte handeln müssen gegen diesen Krieg. Emmanuelle Béart schließlich wirkt über weite Strecken schauspielerisch überfordert. Die leicht trotzige Indifferenz, die ihre Rolle als sperrige Maler-Muse in der "Schönen Querulantin" von Jacques Rivette so geheimnisvoll widerständig scheinen ließ, beginnt hier tendenziell zu langweilen. Wäre Jeanne eine Dichterin gewesen, könnte man sie eine Kämpferin nennen, enthüllt uns das Presseheft, "aber sie ist nur eine untreue Frau, eine Ehefrau, eine französische Frau".
Die Konventionalität des Melodrams trifft unerbittlich. Wohlwollend hat man dem Film zugute gehalten, er skizziere ein Frauenschicksal zwischen Weltkrieg und achtundsechziger Bewegung, gleichsam erste Gehversuche weiblicher Individualität. Aber anders etwa als Isabelle Huppert, die in "Entre nous" von Diane Kurys die einschnürende Enge und Fünfziger-Jahre-Rigidität eines Frauenlebens in der Provinz eindrucksvoll verkörperte, implantiert Emmanuelle Béart ihrer Rolle eine Körperlichkeit der neunziger Jahre, jene selbstgewisse Blasiertheit, die sich aus dem sexuellen Überdruß, nicht aus dem Mangel speist. Wenn sie im aufreizend roten Abendkleid in die Polizeiwache stöckelt, um ihren aufgegriffenen Sohn wieder abzuholen, meint man, Kim Basinger habe sich nach Paris verirrt. Dabei hätte der Film durchaus etwas zu sagen, über die himmelschreiende Ungerechtigkeit in der Bewertung männlicher und weiblicher Untreue, über die Dekonstruktion des französischen Siegermythos, die Unvereinbarkeit militärischer und ziviler Lebensformen, über eine Liebesbeziehung zwischen der Frau eines Siegers und einem Besiegten, über die Schwierigkeit, eheliche Dauer und leidenschaftliche Begegnung zu vereinen, über das Recht auf ein Glück jenseits der Konvention. Aber unbeholfene Regie und enervierende Dialoglastigkeit lassen den Film verstummen. CHRISTIANE VON WAHLERT
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

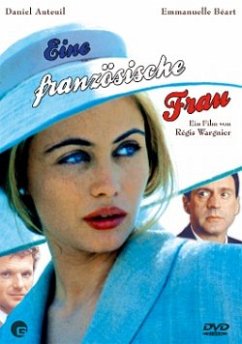

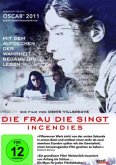

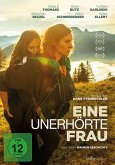

 FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG
FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG