Orlando Bloom spielt in dieser lebensbejahenden, herzergreifenden Geschichte Drew Baylor, einen aufstrebenden Designer, dessen Leben sich eines Tages schlagartig ändert. Drew trifft Claire (Kirsten Dunst). Sie ist wunderschön, steckt voller Lebensfreude und beschließt, Drew auf seiner Reise zurück nach Hause zu begleiten. Sie zeigt ihm, was es heißt zu leben und zu lieben. Manchmal führt ein Film uns dorthin, wo Herz, Humor, großartige Musik und eine unvergessliche Geschichte sich treffen ... Willkommen in Elizabethtown!
Drew Baylor (Orlando Bloom) hat das, wovon Männer träumen: einen gut bezahlten Job und eine Affäre. Als er beides verliert, ist sein Leben nichts weiter als ein Trümmerhaufen. Warum es nicht gleich beenden? Kurz bevor er seinem Leben ein Ende setzen möchte, schlägt das Schicksal erneut zu. Drew erhält die Nachricht vom Tod seines Vaters, und damit gibt es wieder eine Aufgabe für ihn. Und so bucht er kurzerhand den nächsten Flug in die Vergangenheit, um den letzten Willen seines Vaters zu erfüllen. Die Reise nach Elizabethtown gestaltet sich als Flug in eine neue Zukunft. Hals über Kopf verliebt er sich in die Flugbegleiterin Claire Colburn (Kirsten Dunst), und als er sie kurz darauf wieder trifft, erkennt er endlich, wie sich Glück anfühlt.
Drew Baylor (Orlando Bloom) hat das, wovon Männer träumen: einen gut bezahlten Job und eine Affäre. Als er beides verliert, ist sein Leben nichts weiter als ein Trümmerhaufen. Warum es nicht gleich beenden? Kurz bevor er seinem Leben ein Ende setzen möchte, schlägt das Schicksal erneut zu. Drew erhält die Nachricht vom Tod seines Vaters, und damit gibt es wieder eine Aufgabe für ihn. Und so bucht er kurzerhand den nächsten Flug in die Vergangenheit, um den letzten Willen seines Vaters zu erfüllen. Die Reise nach Elizabethtown gestaltet sich als Flug in eine neue Zukunft. Hals über Kopf verliebt er sich in die Flugbegleiterin Claire Colburn (Kirsten Dunst), und als er sie kurz darauf wieder trifft, erkennt er endlich, wie sich Glück anfühlt.
Bonusmaterial
DVD-Ausstattung / Bonusmaterial: - Kapitel- / Szenenanwahl - Featurettes
Kitsch- und Kampfkino: Ron Howards "Cinderella Man" und Cameron Crowes "Elizabethtown" in Venedig
VENEDIG, 5. September
Die besten Drehbücher schreibt das Leben selbst. Der vorzeitige Fall und mirakulöse Wiederaufstieg des Boxers Jim Braddock, der 1935 als 1:10-Außenseiter Boxweltmeister wurde, bietet dem Regisseur Ron Howard so ein Drehbuch für seinen "Cinderella Man", der nach der Premiere in Venedig am Donnerstag auch in die deutschen Kinos kommt: Ein armer Familienvater aus einem Kaff in New Jersey bringt in der Armut der großen Depression die Familie mit Gelegenheitsarbeiten im New Yorker Hafen durch, obwohl er sich im Ring die Hand gebrochen hat. Kämpfen darf er nun nicht mehr, viele Möbel hat er verkauft, Strom und Heizung sind abgestellt. Er hungert, damit die Kinder ein Frühstück bekommen. Da kommt die Chance, als Prügelknabe noch einmal in den Ring zu steigen.
"Cinderella Man" taufen die New Yorker Zeitungen dieses Aschenputtel, das sich mit jedem Sensationssieg als Volksheld aus der Misere herausboxt. Russel Crowe, der für solche Gladiatorenrollen die passende Mischung von Charme, Torheit und Kraft mitbringt, darf diesen Helden des New Deal ohne jede Schattierung geben. Wie zärtlich er mit den Kindern ist. Wie anständig und demütig er im Box-Business auftritt. Mit dem Taxi fährt er aus dem schäbigen Souterrain zum Madison Square Garden, dieweil seine stets geliebte Mae (als irisch-mütterliches Gegenstück mindestens so knuddelig: Renée Zellwegger) den großäugigen Sprößlingen die Milch aufkocht, für die Papa sich gerade herumprügelt.
Die Botschaft dieses Kampfkinos ist deutlich: Jeder kann es schaffen. Sogar die Sozialhilfe, die Braddock erbetteln mußte, zahlt er brav zurück, und die Steaks, zu denen ihn ein Promoter einlädt, trägt er im Taschentuch heim zur Familie. Nur ein halbgarer Arbeitskollege muß in diesem wahren Märchen dran glauben, denn er beging die Dummheit, sich bei Gewerkschaften und Sozialisten zu organisieren. Dann schon besser boxen, denn das ist zwar schmerzhaft, doch ungemein ehrliche Arbeit. Der Film prügelt diese törichte Lektion dem Publikum in mitreißend nachgestellten Kampfszenen - dem Löwenanteil der Handlung - förmlich ein. Daß im Boxgeschäft der New Yorker Mafia-Blütezeit Schiebung Tagesgeschäft war, daß es da Gangster und Nutten im Rudel gab, daß die Armut nicht sentimentale Familienbilder im Gegenlicht, sondern Ausbeutung, Dreck und Tod bedeutete - all dies kommt im katholisch-irischen Idyll nicht vor. Braddock siegt mit der Kraft des Hungers, dient ehrenhaft im Weltkrieg und sorgt sich danach als gemachter Mann vorbildlich um seine Untergebenen. Und wenn er nicht gestorben wäre, müßte George W. Bush diesem heiligen Haudrauf sofort die Verdienstmedaille verleihen.
Wenn Amerika solche Kitsch-Helden braucht, ist es mit dem Land weit gekommen. Doch die Komödie "Elizabethtown" führt vor, daß es noch ärger geht. Das klassische Fluchtgenre des Roadmovie, das mit den kiffenden Motorradrockern von "Easy Rider" ein Gegenbild zur amerikanischen Biederkeit entwarf, löst hier die Rückfahrtkarte zum patriotisch-konservativen Kleinbürgertum. Und Orlando Bloom, der als strahlend-jugendlicher Kreuzritter die Moral des Irak-Kriegs ins Mittelalterliche rückübersetzen durfte, führt nun das Kunststück vor, wie man sich in den verschlafenen Südstaat Kentucky verlieben kann, wenn das Vaterland es befiehlt.
Eigentlich ist es ein Wunder, wie der Regisseur Cameron Crowe 133 Minuten ohne nennenswerte Handlung herumbringt. Dieser Film zielt pfeilgrad aufs Gefühl. Daß ein in der New Economy gescheiterter Bubi seine zartfühlende Stewardess Claire (als zuckersüßes Modell: Kirsten Dunst) bekommen würde, steht nach ein paar Minuten fest. Doch die Pointe liegt in der fröhlichen Regression dieses Helden. Er hat die falsche Welt des globalen Marktes hinter sich gelassen, um die uramerikanischen Wurzeln seiner Familie zu entdecken. Im verschlafenen Nest Elizabethtown träumen Altersgenossen den ewigen Traum von der Rockband, kümmern sich dicke Mammies um die Familien, wuseln widerspenstige Kinderscharen mit Gewehren durch die Vorgärten, sammeln Veteranenverbände Spenden, baumeln alle paar Meter stolze Fahnen im schlappen Wind des Südens. Ist das nicht herrlich?
Lange möchte man meinen, dieses patriotische Idyll sei satirisch gemeint und all die powere Häßlichkeit der Kleidung, der Frisuren, der geröteten und verfetteten Gesichter diene wenigstens augenzwinkernd einer zaghaften Kritik. Doch geht der Film tatsächlich komplett in einer Jubelfeier des bodenständigen, allzeit vollbetankten Amerika und seiner stupenden Simplizität auf. Man hält zusammen, ein Platz auf der Marineakademie in West Point bedeutet hier immer noch höchsten Adel, und die kleinen Kinder haben beim Spielen schon echte Helme aus Daddys Sammlung auf. Schwarze Hautfarbe, wie sie jetzt bei der Katastrophe von New Orleans das andere, das betrogene Amerika vorzeigte, ist übrigens in diesen verlogenen, von Country-Pop umspülten Südstaaten überhaupt nicht zu sehen. So filmt der Weißwäscher Crowe verbissen gegen die ungemütliche Wirklichkeit der Leichensäcke aus dem Irak an. Aber ob Amerika mit Boxen und Autofahren das nur zu berechtigte Unbehagen über sich selbst loswerden kann? Das Drehbuch für den Film, der darauf antwortet, wird gerade vom Leben geschrieben.
DIRK SCHÜMER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

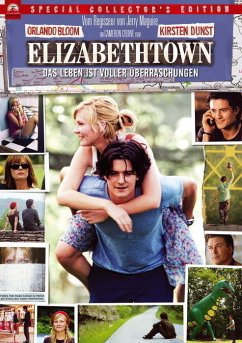







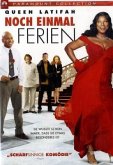



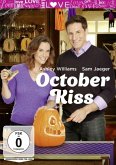
 FSK: ohne Alterseinschränkung gemäß §14 JuSchG
FSK: ohne Alterseinschränkung gemäß §14 JuSchG