Eva Duarte wird als uneheliches Bauernkind westlich von Buenos Aires in armen Verhältnissen geboren. Von Kind auf leidet sie unter dem einfachen Leben ihrer Familie auf dem Land. Im Alter von 15 Jahren kehrt sie daher dem Landleben und ihrer Familie den Rücken. Evas unbändiger Ehrgeiz treibt sie nach Buenos Aires, denn hier hofft sie, ihren Traum zu erfüllen. Sie will unbedingt berühmt werden und kämpft sich in der Großstadt durch: sie spricht für Rollen vor, singt und modelt. Schon nach kurzer Zeit ist ihr Gesicht und Name in ganz Buenos Aires bekannt. Abends besuchte sie die angesagtesten Clubs, um einflussreiche Männer kennen zu lernen. Schon bald schafft sie durch ihre Beziehungen den Schritt zu einer eigenen Radiosendung. Auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung lernt sie den aufstrebenden Politiker Juan Perón kennen und verliebt sich in ihn. Auch Perón empfindet mehr als nur Freundschaft für Evita. Er führt Evita in die gehobene Gesellschaft von Buenos Aires ein. Kurz nach ihrer Hochzeit wählen die Argentinier Juan Perón zum Präsidenten. Evita geht in der Rolle der First Lady auf. Alles was sie sich als Kind erträumte, ist Wirklichkeit geworden: Reichtum, Anerkennung und Liebe. Doch dann erhält sie eine schreckliche Nachricht

Madonna gibt ihr Bestes, Alan Parker nicht: "Evita", die Filmoper
NEW YORK, 7. Januar
Niemand kann von einem Musical Aufklärung erwarten, von Andrew Lloyd Webber Operntalent und von Hollywood historische Wahrhaftigkeit. Die Aussichten für die Verfilmung eines Musicals von Andrew Lloyd Webber über das Leben der argentinischen Diktatorengattin Eva Perón als Rockoper waren also von Beginn an begrenzt. Vielleicht dauerte es deshalb zwanzig Jahre, bis das Vorhaben Wirklichkeit wurde. Immerhin aber konnte man erwarten, daß der Regisseur Alan Parker einen Film dreht - also bewegte Bilder in Sequenzen ordnet -, wenn er sich des Vorhabens erbarmt. Doch auch diese Erwartung wurde enttäuscht.
"Evita", der Film, hat nichts, was an Kino in seiner bekannten Form entfernt erinnerte, außer drei Hauptdarstellern - Madonna als Evita, Antonio Banderas als brechtschen Erzähler Ché und Jonathan Pryce als Juan Perón -, die ihre Sache so gut machen, wie unter den Umständen möglich. Sie sind Standbilder, keine Figuren, und sie spielen nicht, sondern posieren in wunderschönen Kostümen und Dekor als Marionetten in einem riesigen Spektakel. Daß sie singen müssen, verlangt das Genre, und so hören wir, wie seit Wochen in den Supermärkten, nun auch im Kino Lloyd Webbers Liedchen aus seinem alten Bühnenmusical aus den siebziger Jahren, die für die Filmversion bombastisch orchestriert wurden. Doch damit hat das Singen noch kein Ende. Wie in einer richtigen Oper wird auch jede Unterhaltung als Rezitativ gegeben, eine Qual, an der Tim Rice, der Librettist, keinen geringen Anteil hat. Er behandelt das Alphabet wie Lloyd Webber die Tonleiter einzig als Ventil zum Ablaß heißer Luft.
Geöffnet wurde es allerdings schon lange bevor die Dreharbeiten in Argentinien und Ungarn begannen, und zwar in London, wo Musik und Gesang aufgenommen wurden. Wir sehen also Darsteller, die in den Kulissen und vor kreischenden Massen nur noch so tun müssen, als ob sie sängen, und das lippensynchron: eine Anstrengung, vergleichbar einem pompösen Karaoke-Wettbewerb, die jedem von ihnen im Gesicht geschrieben steht. Nur Madonna kann aus ihrem Erfahrungsfundus mit Musikvideoclips schöpfen, dem einzigen bisher bekannten Format, dem "Evita" ähnlich wäre, dauerte der Film nicht zweieinviertel Stunden, in denen er, abgesehen von ein paar Schnitten aus der Klippschule der Parallelmontage, nahezu vollständig auf jede Bilddramaturgie verzichtet.
Die Geschichte geht ungefähr so, daß Eva Duarte, in Armut aufgewachsen als illegitime Tochter eines Großgrundbesitzers, mit fünfzehn Jahren als Geliebte eines Schnulzensängers nach Buenos Aires kommt, sich dort durch die Betten von Fotografen und Besetzungsagenten hocharbeitet zu zweitklassigen Rollen bei Radio und Fernsehen, bis sie - wir befinden uns inzwischen in den frühen vierziger Jahren, ein Putsch folgt auf den anderen - den Sex-Appeal von Uniformen entdeckt und den der Macht, die sie repräsentieren. 1944 trifft sie einen Oberst, Juan Perón, den später gewählten Diktator und Bewunderer Francos und Mussolinis, und ihr Aufstieg geht weiter. Sie wechselt Haarfarbe und Garderobe und nimmt sich der Armen des Landes an, stirbt mit dreiunddreißig Jahren an Krebs und ist seitdem unvergessen.
Es ist eine Geschichte voller dramatischer sexueller, politischer, sozialer und mythologischer Implikationen, eine schwarze Komödie, der sich nur annehmen sollte, wer Sinn für das Groteske hat, und zwar in immensen Ausmaßen. Doch im Film sehen wir davon nichts, selbst alles, was Musicals gemeinhin erträglich macht, nämlich Romantik, Witz und Phantasie, enthält Parker uns vor. Statt dessen sehen wir Massen, Chöre von Soldaten, Bauern, Aufständischen, englischen Kolonialisten und Metzgern; Massen, denen Evita ihre Lieder singt, denen sie zuwinkt, die sie beschenkt und bemuttert. Doch die Chöre singen nicht einmal, jedenfalls nicht oft, und wenn sie es tun, wie die Soldaten, nähme man sie ernster, wenn sie dabei nicht duschen müßten.
Seit Wochen schon, lange bevor "Evita" an Weihnachten in ein paar wenigen ausgewählten Kinos in Los Angeles und New York zu fast ausnahmslos entgeisterten Kritiken startete, war der Evita-Trend ein alter Hut. Die Büchertische bogen sich unter Evita-Büchern, das Fernsehen zeigte Evita-Filme, Bloomingdale's richtete eine Boutique ein, Evita-Make-up, -Lippenstift und -Nagellack waren im Angebot, und auch die Bilder Evitas, die Historiker und Groschenromanautoren entwarfen, als Heilige und Märtyrerin, Modepuppe, Faschistin, Abenteurerin, Hure, Hexe und balsamierte Leiche waren Legion. Doch außer für die Boutique scheint sich Alan Parker, der mit Oliver Stone das Drehbuch geschrieben hat, für nichts von alldem interessiert zu haben. Madonna ist wunderschön in den Kostümen Diors und aufgenommen von Darius Khondij, doch sie bleibt ohne Gefühl, und wir erfahren nichts über sie, nicht einmal genregemäß über die Hure, die Hexe oder die Faschistin, von ihrer unsterblichen Seele zu schweigen.
Evita selbst soll kurz vor ihrem Tod eine postmortale Maniküre angeordnet und der Spezialist, der ihre Leiche balsamierte, acht identische Leichname angefertigt haben, die jahrzehntelang an verschiedenen Orten der Welt auftauchten, verehrt und manchmal auch begraben wurden. "Evita", der Film, hat sie ein weiteres Mal einbalsamiert, und der Kinobesuch gleicht einer Wallfahrt, bei der kein Trick ausgelassen wird, das Publikum in die Rolle der bebenden, schreienden, schließlich schluchzenden Menge zu drängen, die aus Evita jene allmächtige Gestalt machte, die Argentinien einst retten sollte. Wofür auch immer sie gelebt hat, aus Machthunger und Geldgier, es muß etwas anderes gewesen sein als dieser Film. VERENA LUEKEN
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

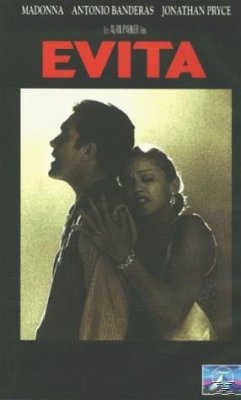
 FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG
FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG