Die Romantrilogie von E.L. James stürmte die Bestsellerlisten und erwies sich sofort als weltweites Phänomen. Insgesamt sind bislang über 90 Millionen Exemplare verkauft und in 52 Sprachen übersetzt worden. Jetzt erobert eine der rasantesten Erfolgsgeschichten der Literatur die Kinos: Bei einem Interview trifft die Studentin Anastasia Steele („The Social Network“) auf den 27-jährigen Milliardär Christian Grey. Trotz seines arroganten und anzüglichen Auftretens kann sie sich seiner geheimen Faszination nicht entziehen – und wird in einen Bann gezogen, der ihr eine ungeahnte Welt eröffnet. Regie führte die Britin Sam Taylor-Johnson („Nowhere Boy“). Produziert wurde FIFTY SHADES OF GREY von Michael De Luca („The Social Network“), Dana Brunetti („Unzertrennlich – Inseparable“) und der Buchautorin E. L. James.
Bonusmaterial
- Die unveröffentlichte Filmversion mit alternativem Ende - Teaser "Fifty Shades Darker" - Hinter den Kulissen - E. L. James & "Fifty Shades" - "Fifty Shades": Die Lust am Schmerz - Christians Wohnung: 360°-Set-Tour - Musikvideos - Hinter den Kulissen von "Earned it" - Die Welt von "Fifty Shades of Grey"
In Bildern denken, mit Würde altern, in SM-Märchen lächeln, in Serien gehen und in Echtzeit erzählen - fünf Blicke auf die 65. Berlinale
Dreht euch nicht um!
Wenn die Berlinale an diesem Sonntag schließt, werden wir zahlreiche Bilder einer Ausstellung gesehen haben. Wir sitzen ihnen gegenüber, den Blick gebannt, mit geschärfter Aufmerksamkeit oder mit der Erschöpfung, die sich nach zu vielen Tagen ohne ausreichende Frischluft einstellt. Dass die Bilder uns auch ansehen, dass die Filme einen mal prüfenden, mal wohlwollenden, manchmal vielleicht vernichtenden Blick auf uns werfen, das ist ein alter Topos vor allem der französischen Cinephilie, dem Antoine Barraud in "Le dos rouge" (im Forum) eine kunstgeschichtliche Pointe gibt. Hier spielt der Filmemacher Bertrand Bonello einen Filmemacher, der ein dürftiges Drehbuch weiterzuentwickeln versucht, indem er sich Bilder und Skulpturen ansieht. Balthus, Moreau und ganz zum Schluss noch eines, von dem ich noch nicht in Erfahrung gebracht habe, ob es sich tatsächlich um ein bekanntes Werk oder um ein eigens für den Film verfertigtes Fake-Bild handelt. Es geht einem jedenfalls durch Mark und Bein, und dem Filmemacher bleibt danach nur noch eine Flucht nach vorne - in die Bilder hinein, in die Auflösung einer Erzählung, die in ihrer verschrobenen Selbstreflexivität und in ihrer sanften Komik an die besten und an die merkwürdigsten Momente des französischen Kinos erinnert.
Es gab dann noch einen zweiten Film auf dieser Berlinale, den ich wie ein Echo auf das Kunst-für-Kunst-Kino von Barraud empfand, ein politisch-historisches Echo, in dem die Bilder albtraumhaftes Gewicht bekommen können: "Pioneer Heroes" ("Pionerygeroi") von der russischen Regisseurin Natalya Kudryashova arbeitet sich an den Heldendarstellungen ab, mit denen Kinder in der Sowjetunion auf ihre Rolle in der kommunistischen Gesellschaft vorbereitet werden sollten. Diese Bilder schneidiger junger Menschen bekommen, jedenfalls für die Zehnjährigen, mit denen Kudryashova arbeitet, etwas Lebensprägendes - eine Existenz im Schatten eines Selbstbildes, mit dem sich Fremdbestimmung zu Panikattacken steigert.
Es war beeindruckend, mit welcher Ruhe und Klarheit die Filmemacherin nach der Vorführung zugleich die Fragen nach einer direkten Aktualisierung ihres Films zurückwies und doch unmissverständlich klarmachte, dass sie "Pioneer Heroes" als Beitrag zu einem dringend erforderlichen "Wandel" in Russland versteht.
Es war einer dieser Momente bei einem Festival, in denen auch exzellente Übersetzer an ihre Grenzen stoßen, weil sie andernfalls an die Bilder heranmüssten, die im Kopf herumspuken und die erst so richtig bestimmen, wie das Reden und das Tun (in einer postsowjetischen Gesellschaft wie der russischen, in einer postheroischen Gesellschaft wie der französischen) zu verstehen sind.
Zweimal rührte die Berlinale für mich hier an Prinzipielles, wie es nur das Kino kann, das Medium, das in denkenden Bildern erzählt.
Bert Rebhandl.
Zeigt eure Falten her!
Das Irritierende an Nicole Kidmans Auftritt als Wüstenreisende Gertrude Bell in Werner Herzogs "Queen of the Desert" liegt nicht darin, dass sie, mit Ende vierzig, zuerst eine Mittzwanzigerin und dann eine Mittvierzigerin verkörpert und in beiden Etappen ihrer Rolle genau gleich makellos aussieht. Es liegt auch nicht darin, dass ihr morgenfrischer Teint weder von persischen Hitzeschüben noch von arabischen Sandstürmen oder Drusen-Überfällen im mindesten erschüttert oder gar beschädigt wird. Nein, was an Kidmans Leinwand-Präsenz in diesem und auch in manch anderem ihrer jüngsten Filme nachhaltig verstört, ist die Tatsache, dass man ihrem Gesicht im Grunde gar kein Alter mehr zuordnen kann. Es ist weder mädchenhaft noch wirklich reif, es trägt weder die Spuren der Zeit noch der kosmetischen Chirurgie. In seiner Ungerührtheit, seiner hermetischen Glätte entzieht es sich unserem Blick, es weicht jedem Kontakt mit der Kamera aus, der es auf dieses oder jenes Lebensstadium festlegen könnte. Nachdem die Botox-Blasen, die Kidmans Züge vor ein paar Jahren entstellt haben, verschwunden sind, ist diese Alterslosigkeit fast noch beunruhigender.
Dass die Stars niemals Runzeln kriegen, gehörte einmal zu den großen Versprechen des Kinos. Greta Garbo löste es ein, indem sie auf dem Höhepunkt ihrer Karriere aus der Öffentlichkeit verschwand, Marlene Dietrich spannte ihre Gesichtshaut mit Nadeln, die sie unter ihren Haaren begrub. Wie lange wird Kidmans Maske halten?
Ganz anders Charlotte Rampling im britischen Wettbewerbsbeitrag "45 Years". Sie spielt eine Frau, die nach viereinhalb Jahrzehnten Ehe hinter die Vorgeschichte ihres Mannes kommt, und sie trägt jede ihrer Falten und Hautflecken mit Anmut und Würde. Die gleiche Beseeltheit gibt sie ihrer Rolle, die eine der undankbarsten ihrer langen Karriere ist, weil sie aus nichts als Bangen und Zweifeln, aus Grübeln und Gekränktsein besteht. Starke Frauen in Extremsituationen, das war das Motto dieses Festivals, aber dort, wo es zu greifen schien, gab es vor allem Äußerlichkeiten zu sehen, verstärkte Fassaden. Für mich war Charlotte Rampling die starke Frau dieser Berlinale.
Andreas Kilb.
Vergesst die Peitsche!
Der Witz ist, dass es leider gar nicht lustig gemeint ist. Wenn in der Verfilmung von E. L. James' "Fifty Shades of Grey" der superreiche Christian Grey die Studentin Anastasia Steele in seinem sogenannten Spielzimmer nun also endlich verführt hat (die hübsche Dakota Johnson als Ana Steele hat sich bis zu dieser Szene bestimmt schon 37 Mal auf die Lippe gebissen, bis Mr. Grey merkt: "Du beißt dir auf die Lippe, das möchte ich auch tun"), macht ihn das leider gar nicht glücklich. Es folgt ein Schnitt. In der nächsten Einstellung sieht man den nackten Jamie Dornan als Grey an einem Flügel traurig und schlecht auf dem Klavier herumklimpern, draußen die Skyline des nächtlich funkelnden Seattle hinter den riesigen Fensterscheiben seiner Angeberwohnung als Kulisse. Krankenschwestermäßig nähert Ana sich ihm und fragt: "Warum spielst du so traurige Lieder?"
Und da muss man im Kino schon sehr kichern und wünschte sich, der Film würde sich hier über sich selbst lustig machen, über den ganzen "Fifty Shades"-Hype, dieses ultrakonservative SM-Märchen, den ganzen Märchenprinzen-Klischeequatsch (Grey hat Ana zu diesem Zeitpunkt schon ein neues Apple-Notebook, einen roten Audi R8 Spider und viele teure neue Kleider geschenkt, und Ana, ganz Bewunderungsgirl, hat jedes Mal dankbar "Wow" gesagt). Als Karikatur, denkt man, würde der Film vielleicht wirklich funktionieren. Nur ist er an keiner Stelle auch nur ein bisschen ironisch. Er ist völlig humorfrei und so unanstößig wie seine Romanvorlage. Angeblich werden zusammengenommen elf Minuten Sex gezeigt, wobei alles, was auf den ersten Blick nach spanischer Inquisition aussieht, liebevoll durch den Weichzeichner gejagt wird. Auch muss Mr. Grey seiner Sadomaso-Vorliebe nur deshalb nachgehen, weil er wegen seiner cracksüchtigen Mutter (einer Prostituierten, die starb, als er vier war) einen Psychoknacks hat. Nicht normal also, das Ganze. Am Ende widersteht die warm empfindende Studentin dem undurchdringlichen, kalten Grey. Alles gut in Amerika.
Vor einer Weile hatte es geheißen, der Schriftsteller Bret Easton Ellis wolle das Drehbuch zum Film schreiben und Gus Van Sant Regie führen. Bei einer Vorlage wie "Fifty Shades" hätte gelten müssen: Je irrer, desto besser. Doch behielt die Autorin E. L. James die Kontrolle über die komplette Besetzung. Und so ist dann auch das Ergebnis. Man muss aufpassen, dass man im Kino nicht einfach wegdämmert.
Julia Encke.
Macht ein Versprechen!
Jetzt darf also auch das kleine Fernsehen endlich auf die große Leinwand. Acht Serien zeigte die Berlinale, jeweils zwei Folgen, was zwar rein physisch in den engen Sitzreihen im Haus der Berliner Festspiele locker ausreichte. Aber trotzdem die Frage aufwarf, ob es nicht eher das Kino ist, das für das Format zu klein ist. Im Vergleich zu den Sechs- bis Zwölf-Stunden-Werken wirkt noch der längste Wettbewerbsfilm wie ein Clip für Menschen mit Aufmerksamkeitsdefizit.
Zwei Folgen sind, das ist das chronische Problem der Serienrezeption, natürlich nicht genug, um sich ein gerechtes Urteil zu erlauben; aber diese Ungerechtigkeit ist eben auch die Bedingung, welcher die Form überhaupt ihre Struktur verdankt, ihr Erzählprinzip, ihre Faszination. Wer will, dass sich die Zuschauer einer kompletten Staffel verschreiben, muss schon am Anfang ein Versprechen abgeben, das bis zum Ende reicht.
Das geht mit den unterschiedlichsten Mitteln. Der italienische Polit-Thriller "1992" schafft es durch die Opulenz seiner Handlungsstränge, das amerikanische Familiendrama "Bloodline" durch Figuren, die so undurchschaubar sind, dass man nach zwei Folgen sogar dem Misstrauen in sie misstraut. Und die schwedische Serie "Blå ögon" (Blaue Augen), bei der es um das Treiben einer rechtsextremen Terrorgruppe geht, erhöht die Radikalität Folge für Folge so behutsam, dass man erst viel zu spät merkt, dass man süchtig ist.
Auch die RTL-Serie "Deutschland 83" war so ein Versprechen, dem man sehr gerne glauben wollte, weil es tatsächlich klang, als hätte nun auch das deutsche Fernsehen die allgegenwärtigen Erfolgsformeln begriffen: "horizontales Erzählen", "character driven story", "writer's room". Aber es reicht eben nicht, wenn man einen Geheimagenten zur Hauptfigur macht; er sollte schon auch ein Geheimnis haben. Erzählt wird die Geschichte des jungen NVA-Soldaten Martin Rauch (Jonas Nay), der gegen seinen Willen als Spion im Westen eingesetzt wird, wo er mit großen Augen vor den Wundern des Kapitalismus steht. Die Amerikaner wollen Pershing-II-Raketen stationieren, der Dritte Weltkrieg droht, was die DDR natürlich verhindern will, wo sie schon hilflos mitansehen musste, wie die Neue Deutsche Welle den Osten eroberte. Und so stolpert der herzensgute Agent durch die lustigen achtziger Jahre, deren Kuriositäten Regisseur Edward Berger bei jeder Gelegenheit ausstellt. Fast jede Szene ist vollgestopft mit Retro-Klischees, überall fahren VW-Busse und Opel Rekords herum, der amerikanische General kaut Kaugummi, geheime Dokumente sind, oh weh, auf einem komischen viereckigen Ding mit einem Loch in der Mitte gespeichert.
Es ist nicht so, dass man sich über diese Ära nicht lustig machen darf. Aber die Serie nimmt sie genauso wenig ernst wie ihre Figuren. Und deshalb reichen auch zwei Folgen, um jedes Vertrauen zu verlieren, dass einen doch noch etwas überraschen wird, ein Bild, ein Gag, die Handlung. "Die achtziger Jahre sind ein Geisteszustand", sagt einmal jemand in "1992". In "Deutschland 83" sind sie nur ein Witz.
Harald Staun.
Erzählt doch mal anders!
Die meisten Regisseure und Produzenten glauben gerne, sie müssten nur weit genug reisen, dann würde sich auch das Erzählen ganz von selbst verändern. Ins ewige Eis, in die Wüste, ins Gestern. Wenn sie überhaupt noch glauben, man brauche nicht nur ein Thema, sondern es gebe auch nur eine ganz bestimmte Art, auf die eine Geschichte erzählt werden müsse. Wer daran festhält, den hält allerdings leicht die Schwerkraft der Konvention fest. Wobei es nun auch nicht reicht, die Konvention einfach abzulehnen. Dann hat sie einen schon wieder eingeholt. Man muss schon mit dem Neuen ins Risiko gehen.
Selbst in einem Berlinale-Wettbewerb gibt es nicht viele Filme, die sich das trauen; und es gibt nicht allzu viele Festivalbesucher, die das Experiment für interessanter halten als die Antwort auf die Frage, ob es denn auch gelungen sei. Im Falle von Wim Wenders, dem Ehrenbären-Empfänger, ist das die ödeste Frage. Einen 3-D-Film wie "Every Thing Will Be Fine" hat noch niemand gedreht. Bis auf ein paar Schneeflocken und flirrende Staubpartikel ist da nichts, wofür das Format angeblich erfunden worden sein soll. Es ist Wenders' Idee, dass es für diese Geschichte von Schuld und schuldloser Verstrickung, von Verdrängung und Vergebung diese besondere Raumillusion braucht, weil nicht nur die Welt der Dinge eine andere Plastizität erhält, sondern sich auch der Raum der Figuren zum Kinosaal hin zu öffnen scheint. Der Einwand, all das hätte man doch genauso gut in 2 D zeigen können, ist armselig - weil er nicht einmal fragt, warum Wenders genau das nicht wollte. Es geht, wie immer bei Wenders, um die Suche nach einer anderen Erscheinungsform von Welt im Kino. Es bleibt eine Suche, weil die Geschichte dann doch mehr als nur eine Spur zu simpel und mechanisch ist. Aber es ist interessanter, als einem Erzählen zuzusehen, das alles schon gefunden zu haben glaubt.
Auch bei Sebastian Schippers "Victoria" waren sich zu viele zu schnell einig, es zähle allein das handwerkliche One-Take-Wunder. Es nervt zwar zwischendurch auch, aber darum geht es letztlich gar nicht. Der Film will auch keinen auf irrste Wendungen versessenen Plot. Indem Schipper in Echtzeit erzählt, ohne Abkürzungen und Schnitte, wird etwas ganz anderes sichtbar: Ist das überhaupt zwingend und notwendig, diese geordnete Folge durchkomponierter Bilder, subtiler szenischer Auflösungen und sinnstiftender Montagen? Ist das wirklich so alternativlos, wenn man vom Nachtleben, von Bankraub, Flucht und Tod erzählen will? Wie "Victoria" die Dinge zeigt, das ist auch eine Attacke auf die geregelte Repräsentation, auf das feste Bild, welches sich das Kino von einem bestimmten Geschehen macht und welches wir uns zugleich vom Kinoerzählen machen.
Bei Terrence Malick ist dieser Impuls, sich den gängigen narrativen Formen zu entwinden, schon länger da. Es ist auch schon länger darüber gespottet worden: über prätentiöse Off-Texte, kitschig-erbaulich-frömmlerische Naturbilder. Und vermutlich haben die Spötter auch ein bisschen recht, ohne es zu ahnen, weil Malick, bevor er für zwanzig Jahre Pause machte, in den Siebzigern schon mal weiter schien bei dem Versuch, über das visuelle Repertoire, den Bilderwortschatz eines Spielfilms hinauszugehen, in "Days of Heaven" oder "Badlands". Wenn er jetzt in "Knight of Cups" mit dem fabelhaften Kameramann Emmanuel Lubezki durch Los Angeles zieht, von Santa Monica bis Downtown und zurück, wenn sie Strände, Straßen, Wüste, Wasser, Häuser, Interieurs, Menschen und soziale Rituale fotografieren, dann ist das immer noch eine große Suchbewegung, in der Stimmungen, Gemütslagen, Hirngespinste, Gedankenblasen mit Landschaften, Topographien und Körpersprachen zusammenkommen sollen, ohne dass die einen zum bloßen Ausdruck der anderen würden. Ein Erzählen voller Überschüsse und Uneindeutigkeiten. Klar, die Kalenderweisheiten, Schwulst und Pathos des Off-Textes können wahnsinnig anöden. Aber man sollte das Ungenügen nicht geringschätzen, das dahintersteckt: Sind nicht die üblichen Einstellungen, Bildfolgen, Auflösungen auf eine Weise standardisiert und normiert, dass sie kaum noch Individuelles erzählen über die Personen, die sie immer schon in diesem Arrangement zeigen?
Malick reibt sich daran, und man kann als Kinogänger irgendwann keine Lust mehr haben, ihn dabei zu begleiten. Aber wo, bitte, wenn nicht auf einem Festival, das nicht wie Berlins "Grüne Woche" den größten Rammler und die dickste Kartoffel präsentieren, sondern auch ein Labor sein soll; wo sonst ist denn noch Raum für ein Erzählen, das sich beim Nächstliegenden, was oft das scheinbar so Exotische ist, langweilt und das sich deshalb mühsam einen eigenen Weg zu bahnen versucht? Das Festival selbst traut sich ja in seiner Neigung zum Gefälligen kaum, mehr solcher Filme auszuwählen.
Peter Körte
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main



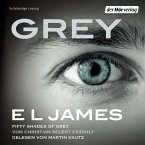
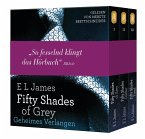







 FSK: Freigegeben ab 16 Jahren gemäß §14 JuSchG
FSK: Freigegeben ab 16 Jahren gemäß §14 JuSchG





