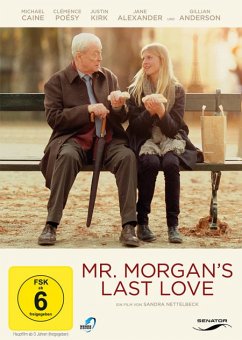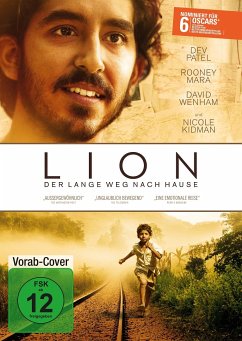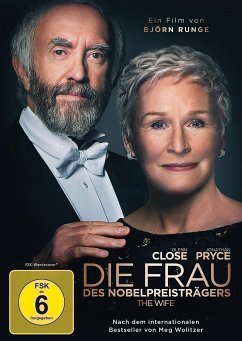Frühstück bei Monsieur Henri
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
12,99 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
6 °P sammeln!
Monsieur Henri ist ein mürrischer alter Herr und stolz darauf. Er lebt allein mit einer Schildkröte in einer viel zu großen Pariser Altbauwohnung und ärgert sich - über die Ehefrau seines Sohnes, die jungen Leute von heute oder was sonst so anfällt. Doch weil Henris Gesundheit letzthin etwas nachgelassen hat, beschließt sein Sohn Paul, dass es Zeit wird für eine Mitbewohnerin. Mit der chronisch abgebrannten Studentin Constance kommt ihm eine junge Dame ins Haus, die all das hat, was Henri auf den Tod nicht leiden kann, die seine Pantoffeln klaut und unerlaubt das Klavier benutzt. Weil ...
Monsieur Henri ist ein mürrischer alter Herr und stolz darauf. Er lebt allein mit einer Schildkröte in einer viel zu großen Pariser Altbauwohnung und ärgert sich - über die Ehefrau seines Sohnes, die jungen Leute von heute oder was sonst so anfällt. Doch weil Henris Gesundheit letzthin etwas nachgelassen hat, beschließt sein Sohn Paul, dass es Zeit wird für eine Mitbewohnerin. Mit der chronisch abgebrannten Studentin Constance kommt ihm eine junge Dame ins Haus, die all das hat, was Henri auf den Tod nicht leiden kann, die seine Pantoffeln klaut und unerlaubt das Klavier benutzt. Weil sich Constance die Miete eigentlich nicht leisten kann, bietet Henri ihr ein skurriles Geschäft an: wenn sie es schafft, seinem Sohn Paul so lange schöne Augen zu machen, bis der seine Ehefrau verlässt, ist die Miete umsonst. Mehr übel als wohl willigt Constance ein. So stolpert der ahnungslose Paul in seinen zweiten Frühling und Constance in eine schrecklich nette Familie, die dank Monsieur Henri heillos im Chaos versinkt.