
Der Titel führt in die Irre. Denn Fans des Genres werden eher nicht auf ihre Kosten kommen, weil der Film die Monster beinahe beiläufig zeigt. Und genau das ist wiederum der Witz von "Monsters", den der junge Brite Gareth Edwards mit einem improvisierenden Schauspielerpärchen für sehr wenig Geld in Zentralamerika gedreht hat.
Eine Einblendung informiert eingangs, dass vor sechs Jahren eine Nasa-Sonde mit außerirdischen Lebensformen über Mexiko abgestürzt sei und der Norden des Landes nun eine "infizierte Zone" sei. Ein hoher Elektrozaun riegelt das Gebiet ab, und wer vom Süden des Landes in die Vereinigten Staaten will, muss das Boot nehmen oder sich von Schmugglern durch die Zone bringen lassen. Zu den Standards des Genres gehört es, dass ein Fotograf (Scoot McNairy) und die Tochter (Whitney Able) seines Verlegers das letzte Boot verpassen und die Landroute nehmen müssen. Aber wie das dann in Szene gesetzt wird, ist schon deswegen ungewöhnlich, weil die krakenhaften Riesenmonster zwar stets präsent, aber selten sichtbar sind.
Am Anfang sieht man einmal grünstichige Videoaufnahmen eines nächtlichen Kampfes zwischen einer Soldateneinheit und einem Alien, aber mehr als einen vagen Eindruck von Größe und Vernichtungskraft bekommt man dabei nicht. Den Aufnahmen wird man gelegentlich wiederbegegnen auf Fernsehern im Hintergrund, wo der nächtliche Zusammenstoß als Nachrichtenschleife wiederholt wird. Überhaupt besticht der Film dadurch, dass er sich nicht im ständigen Ausnahmezustand befindet, sondern eine Situation zeigt, in der sich alle mit der Anwesenheit der Aliens arrangiert zu haben scheinen und die Zone als "Normalität" wahrnehmen, mit der man eben leben muss. Es herrscht Krieg, aber da er auf die Zone beschränkt ist, erinnern nur der Zaun, die tieffliegenden Kampfjets der Amerikaner und die allgegenwärtigen verwitterten Warnschilder an seine Präsenz. Und all das hat der sonst für Computereffekte im Fernsehen tätige Regisseur in Heimarbeit so in seine Aufnahmen eingebaut, dass eben spürbar wird, dass sich die Welt in sechs Jahren an so ziemlich alles gewöhnen kann - selbst an Aliens.
Das Miteinander des unfreiwilligen Paares ist nicht übermäßig interessant, aber das ist es in diesen Filmen ohnehin selten. Und bei der Dschungeldurchquerung rührt die Angst weniger vom fernen Gebrüll der Monster als von der Unsicherheit, wem sie sich auf dieser Reise ausliefern. Erst wenn die beiden am anderen Ende der Zone angelangt sind, wird aus der Orientierungslosigkeit von Rucksacktouristen ein richtig gespenstisches Abenteuer. Hinter der gigantischen Mauer, hinter der sich die Vereinigten Staaten verschanzt haben, liegt eine Zone der Verwüstung, die an "Katrina" erinnert. Und beim Finale an einer verlassenen Tankstelle kommt es dann zu einem seltsamen Paarungstanz der Aliens, vor dem der Mensch nur noch wie eine Lebensform unter vielen wirkt. Das ist für einen Horrorfilm schon ganz schön gruselig.
MICHAEL ALTHEN
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

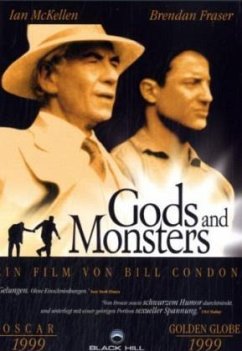
 FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG
FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG