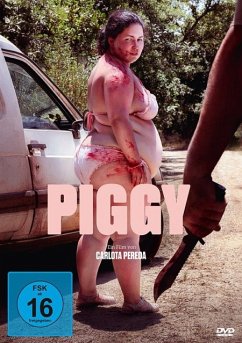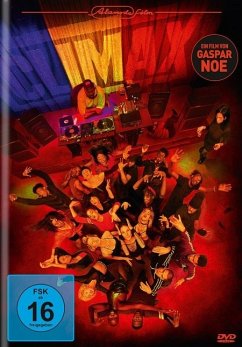High Life
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 3-5 Tagen
16,99 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
8 °P sammeln!
In den Tiefen des Weltalls. Jenseits unseres Sonnensystems. Monte (Robert Pattinson) und seine Tochter Willow (Jessie Ross) leben zusammen an Bord eines Raumschiffs, Raumschiff Nummer 7. Steuerungslos und gänzlich isoliert schweben sie durchs All, der Tag nur gegliedert durch Reparaturarbeiten und tägliche Statusreports an die Erde. Sie sind Teil einer experimentellen Mission, die außer Monte und Willow niemand überlebt hat. Eine Gruppe zum Tod verurteilter Straftäter hat ein Angebot des Staates angenommen: Lebenswichtige Energieressourcen im All zu finden und im Gegenzug dafür die Straf...
In den Tiefen des Weltalls. Jenseits unseres Sonnensystems. Monte (Robert Pattinson) und seine Tochter Willow (Jessie Ross) leben zusammen an Bord eines Raumschiffs, Raumschiff Nummer 7. Steuerungslos und gänzlich isoliert schweben sie durchs All, der Tag nur gegliedert durch Reparaturarbeiten und tägliche Statusreports an die Erde. Sie sind Teil einer experimentellen Mission, die außer Monte und Willow niemand überlebt hat. Eine Gruppe zum Tod verurteilter Straftäter hat ein Angebot des Staates angenommen: Lebenswichtige Energieressourcen im All zu finden und im Gegenzug dafür die Strafe erlassen zu bekommen. Ein trügerischer Deal. Und für die Crew eine Reise ohne Wiederkehr. So nähern sich auch Vater und Tochter ihrem letzten und unausweichlichen Ziel - dem Schwarzen Loch, dem Ende von Zeit und Raum.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.