Der erste Spielfilm des österreichischen Dokumentarfilmregisseurs Ulrich Seidl. Ein raues Porträt - großartig umgesetzt von einem Ensemble aus Laien und Profis-, das unter die Haut geht und in größter Trostlosigkeit doch immer wieder Glücksmomente findet.
Bonusmaterial
DVD-Ausstattung / Bonusmaterial: - Kein Bonusmaterial
Das Filmfestival in Venedig zeigt böse Spießer aus Österreich und zornige Arbeiter aus England
VENEDIG, 4. September.
Im Frühstücksraum des Lido-Hotels "Atlanta Augustus" hängt eine Reproduktion, auf der ein gigantischer Hamburger aus der Lagune steigt und mit seinen Käsefäden den Campanile von San Marco zu verschlingen droht. Fürchtet nun auch Venedig die Globalisierung? Die Bilder aus Genua, von Hunderten Kameras aufgezeichnet und in abertausend Variationen in die Fernsehkanäle dieser Welt eingespeist, haben in den Spielfilmen am Lido noch keinen sichtbaren Abdruck hinterlassen. Nur eine überfüllte Pressekonferenz, auf der zwanzig italienische Regisseure in markig-antiglobalen Worten ihr gemeinsames Kinoprojekt zum Genueser Gipfel vorstellten, sorgte für einen kurzen Moment der Aufregung, dann ging das Festival wieder seinen gewohnten Gang.
Der Hamburger aus Hollywood hat Venedig noch nicht verspeist. Dafür hungern die Venezianer nach Woody Allen. Als am Wochenende Allens neues Werk "The Curse of the Jade Scorpion" (F.A.Z. vom 29. August) auf dem Lido lief, brach die bis dahin fleckenlose Festivalorganisation zum ersten Mal zusammen, Warteschlangen gerieten außer Kontrolle, Fäuste flogen vor dem Kinosaal, und eine hastig angesetzte zusätzliche Mitternachtsvorführung mußte die erhitzten Gemüter besänftigen. Andere Filme hatten es deutlich schwerer, den Appetit der Zuschauer zu wecken. Nanni Moretti, der Präsident der Jury, soll nach zehn Minuten aus Ulrich Seidls "Hundstage" herausgelaufen sein. Das muß noch nichts bedeuten, schließlich vergeben noch sechs weitere Juroren den Goldenen Löwen, aber ein gewisses Handikap lastet nun doch auf Seidls Film. Vielleicht kann der österreichische Regisseur sich größere Hoffnungen auf einen anderen, von einer zweiten Jury vergebenen Löwen machen, den "Leone del futuro" für den besten Kinoerstling, denn "Hundstage" ist sein Spielfilmdebüt.
Seidl, Jahrgang 1952, dreht seit elf Jahren Dokumentationen, die in seiner Heimat heftig umstritten sind. Um die Bizarrerien der österreichischen Wirklichkeit schlagender zum Vorschein zu bringen, reichert Seidl seine filmischen Funde mit fiktiven Einfällen an. Die Menschen vor seiner Kamera spielen sich selbst; aber sind sie, die Spielenden, denn noch sie selbst? Auch "Hundstage" operiert mit dieser Zweideutigkeit von Schein und Essenz, aber unter umgekehrten Vorzeichen: Jetzt ist das Ganze fiktiv, und die dokumentarische Wahrheit steckt in den Details. Ein Vorort von Wien in der Hitze des Sommers: Spießer, Streuner, Greise, Teenager, Proleten und Pedanten am Rande des Nervenzusammenbruchs. Ein Sportwagenfahrer mißhandelt seine Freundin. Ein in Scheidung lebendes Paar macht einander im gemeinsamen Haus das Leben zur Hölle. Eine Anhalterin betet jedem, der sie mitnimmt, die neuesten Verbraucherstatistiken und Werbespots herunter. Eine ältere Lehrerin läßt sich von ihrem Freund, einem Zuhälter, den Kopf in die Kloschüssel stecken. Ein Vertreter für Sicherheitsanlagen vergiftet den Hund eines alten Witwers, der seinen Hochzeitstag dadurch begeht, daß er seine Haushälterin für sich strippen läßt.
Obwohl in "Hundstage" außer dem Hund niemand stirbt, fühlt sich der Film wie ein Massaker an: ein Gemetzel der Seelen, Sinne, Emotionen. Was sein Landsmann Michael Haneke in seiner Österreich-Trilogie planmäßig abtastet, haut Seidl mit einem Holzhammerschlag auf die Leinwand: die Selbstzerstörung des bürgerlichen Milieus. Aber Haneke hat ein Konzept, Seidl nur ein paar Ideen. So enthält sein Film gerade das nicht, was ein Episodenkino à la "Hundstage" erst interessant macht: eine Haltung, die über das Vorzeigen schlimmer Kuriositäten hinausgeht. Seidl, heißt es, habe sich bei den Dreharbeiten ganz in den Dienst seiner Laienschauspieler gestellt, und zum Dank geben die Darsteller vor Seidls Kamera ihr Äußerstes, aber in diesen szenischen Verpuffungen erschöpft sich der Film dann auch. Er zeigt Hitze, doch er vermittelt sie nicht. Die eindrucksvollste Einstellung in "Hundstage", das Porträt der zerstrittenen Eheleute, die schweigend im Garten auf der Schaukel ihres toten Kindes sitzen, spielt nicht zufällig im Regen. Ein Ensemble schöner Bilder, heißt es in Bressons "Noten zum Kinematographen", könne abscheulich sein; aber auch eine Sammlung von Schrecknissen ist, wie "Hundstage" zeigt, nicht notwendig schön.
Von Schrecknissen hat Ken Loach noch nie erzählt, dafür berichtet er von den immergleichen Fehlern im System: Kapitalismus, Privatisierung, Ausbeutung der Arbeiterschaft. Auch Loachs britischer Wettbewerbsbeitrag "The Navigators" hat diesen Geschmack des Immergleichen, der an die Stilleben eines Genremalers oder die Songs von Rod Stewart erinnert, je nachdem, zu welcher Kultur man sich rechnet. Der Film selbst ist allerdings mehr Stewart als Brueghel, er klappert mit rotziger Emphase die Stationen des Zerfalls einer Gruppe von Bahnarbeitern ab, die zu Opfern der New-Labour-Wirtschaftspolitik der späten neunziger Jahre werden. "Paul, Mick und die anderen" heißt der Film auf italienisch, und damit ist schon das meiste über den Erzählton dieses Gruppenporträts gesagt, das man, wenn man will, auch auf ein Antiglobalisierungsmärchen herunterrechnen kann: British Rail gegen den Rest der Welt. Solange Loach damit fortfährt, im Kino solche verlorenen Schlachten nachzustellen, findet er, wie es scheint, in Venedig immer einen Unterschlupf.
Ganz anders, nämlich düster, labyrinthisch und mit Hintertüren gepflastert, sieht die Welt bei David Mamet aus. "Heist" ist eine Gangstergeschichte der klassischen Mamet-Art, in der jeder jeden betrügt und alle zusammen die Polizei, und vielleicht sollte auch der amerikanische Regisseur zur Abwechslung einmal eine andere Platte auflegen, bevor wir seiner virtuosen Spielereien überdrüssig werden. Aber wenn Gene Hackman am Ende der Geschichte dieses Siegerlächeln aufsetzt, das nur er aufsetzen kann, das Lächeln eines Mannes, der einen Hamburger ebenso zu schätzen weiß wie einen Lastwagen voller Gold, dann weiß man, daß sich das Warten gelohnt hat. Mit diesem Lächeln geht man am Lido gern in den Tag.
ANDREAS KILB
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

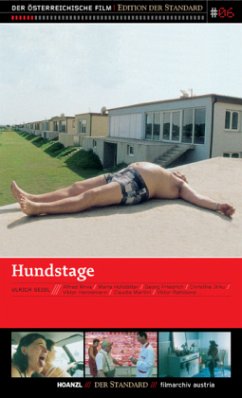
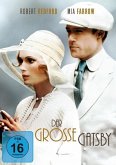






 FSK: Freigegeben ab 16 Jahren gemäß §14 JuSchG
FSK: Freigegeben ab 16 Jahren gemäß §14 JuSchG