Indiana Jones, ein junger Archäologe, schreckt vor keiner Gefahr zurück, um historische Schätze zu bergen. Kaum ist er dem heißen Dschungel Südamerikas mit einem uralten, geheimen Inkaschatz entkommen, da wartet schon das nächste Abenteuer auf ihn. In Ägypten begibt er sich auf die Suche nach einer geheimnisvollen Bundeslade, welche die original Steinplatten von Moses 10 göttlichen Geboten enthält. Nicht die historische Bedeutung ist das reizvolle an dieser Aufgabe, sondern eine geheimnisvolle übermenschliche Kraft, die sich derjenige zunutze machen kann, der die Truhe besitzt. Diese Tatsache fordert auch einen anderen Mann heraus, der mit solchen Mächten ausgestattet Herrscher über die Welt werden könnte: Adolf Hitler. Er schickt seine besten Männer, um Indiana Jones zuvorzukommen.
Bonusmaterial
Enthält 4K UHD & Blu-ray
Wie James Bond, nur ohne Technik: Steven Spielberg machte Indiana Jones zu einem unsterblichen Helden.
Als George Lucas sich 1981 in den Kopf setzte, mit dem peitschenschwingenden Archäologen Indiana Jones eine Wiederbelebung alter Abenteuerfilme ins Kino zu bringen, waren seit der Glanzzeit dieses Kinogenres vier Jahrzehnte vergangen. Mittlerweile liegt die Premiere des ersten "Indiana Jones"-Films genauso lange zurück. Und da gerade an diesem Donnerstag beim Filmfestival in Cannes der nunmehr fünfte Teil der Reihe ("Indiana Jones und das Rad des Schicksals") einem Publikum vorgestellt wurde, das Harrison Ford abermals in der Hauptrolle bestaunen durfte, lohnt ein Blick zurück auf die Anfänge. Oder kürzer gefragt: Ist "Jäger des verlorenen Schatzes" nach vierzig Jahren so angestaubt, wie Lucas die Vorbilder des Genres vorgekommen sein mögen?
Beim abermaligen Ansehen zerstreuen schon die ersten Bilder des Films diese Bedenken: Es ist das Jahr 1936, Männer schleichen durch den Urwald, ihre Körper sind zwischen den Baumstämmen nur als schattige Silhouetten erahnbar, der Held schon hier mit dem Hut markiert, der später sein Markenzeichen werden soll. All das spielt mit den Tropen der Genreklassiker, macht Indiana Jones zu einer modernen Version der britischen Roman- und Filmfigur Allan Quatermain. Und es ist nicht die einzige britische Anleihe, die hier zugrunde liegt. Als Lucas seinem Freund Steven Spielberg das Konzept für "Indiana Jones" vorstellte, soll dieser amüsiert festgestellt haben: "Das ist wie James Bond, nur ohne das technische Spielzeug." Und damit war Spielberg als Regisseur an Bord, denn auch die Arbeit an einem Agentenfilm hätte er damals nicht ausgeschlagen. Er zieht "Jäger des verlorenen Schatzes" nach ähnlichem Muster auf wie die Filme über den britischen Geheimagenten mit der Lizenz zum Töten: ein Anfang, der mitten ins Geschehen springt und so viel Tempo vorlegt, dass er kaum Zeit zum Atmen lässt, nur um den Einsatz von da an kontinuierlich zu steigern. Spielberg beginnt seinen Abenteuerfilm also mit einer halsbrecherischen Verfolgungsjagd im südamerikanischen Dschungel, die Männer sind schon bald nicht mehr nur Silhouetten, sie kämpfen sich durchs Dickicht. Macheten legen den überwucherten Eingang eines alten Tempels frei, der Archäologe Jones muss Giftpfeilen und Tretfallen ausweichen, die angespitzte Gitter niedersausen lassen, um einen sagenumwobenen Goldschatz zu entwenden.
Harrison Ford, der damals bereits in zwei "Star Wars"-Filmen als Han Solo seine Qualifizierung für den draufgängerischen Helden unter Beweis gestellt hatte, verlegt sich hier aufs Raue, wirkt fast schon so wortkarg wie einst Gary Cooper. Seine wenigen Sätze macht Ford durch Körperarbeit wett. Einmal leuchten Emotionen auf, wenn Jones mit dem (vermeintlichen) Tod seiner Komplizin Marian konfrontiert wird. Das Drehbuch trägt ihm auf zu tun, was auch Cooper getan hätte: Er setzt sich mit einer Flasche Schnaps in eine Bar. Er trinkt und schweigt, sein Blick aber nimmt die mürrische Wehmut eines verlassenen Bulldoggen-Welpen an. Der Grund seiner Verzweiflung, die kluge Marian (Karen Allen), der er seine Gefühle nicht gestehen konnte, ist ein weiterer Pluspunkt dieses Films. Später mangelte es Jones an Frauen solchen Formats. Im "Tempel des Todes" musste sich Kate Capshaw aufs Kreischen beschränken, Alison Doody konnte im dritten Teil dann immerhin eine kompetente Nazi-Gegenspielerin zu Jones auf der Suche nach dem heiligen Gral mimen, aber keine von ihnen kam an Allens trinkfeste Barbesitzerin aus Nepal heran, die Hitlers Agenten auch mal ein Flugzeug entwendet und wusste, wie man mit einer Waffe umgeht.
Der amerikanische Filmkritiker Harlan Ellison pries "Jäger des verlorenen Schatzes" kurz nach dessen Premiere als einen Höhepunkt in Spielbergs Schaffen und ordnete ihn als Pop-Meisterwerk ein, das mit eigener Stimme und Ehrfurcht vor dem Genre überzeuge. Diese eigene Tonart schlug Spielberg früh an; schon erste Fernsehproduktionen tragen seine Regie-Handschrift. Das zeigt sich zum Beispiel 1971 in der ersten Folge der Krimiserie "Columbo", für die Spielberg aus dem fast quadratischen 4:3-Fernsehbildformat größtmögliche Raumtiefe herausholt, indem er Darsteller in manchen Szenen sowohl Vorder- als auch Hintergrund im Bildaufbau bespielen lässt - maximale Information bei minimalem Szenen- und Zeitaufwand. Eine Technik, die sich auch in "Jäger des verlorenen Schatzes" wiederfindet. Das Entfalten einer Schatzkarte inszeniert Spielberg so, dass sowohl Indiana Jones' Hände, die die Karte halten, als auch die gierigen Blicke der Expeditionsteilnehmer im Bild zu sehen sind. Der Konflikt deutet sich schon an, setzt die nächsten Szenen unter Spannung. Und wenn Indiana Jones dann die Peitsche hervorholt, um das diebische Vorhaben seiner Mitstreiter zu unterbinden, ist man plötzlich wieder vierzehn Jahre alt und will nach dem Ende des Films die Abenteuerromane hervorholen - oder demnächst ins Kino gehen. MARIA WIESNER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

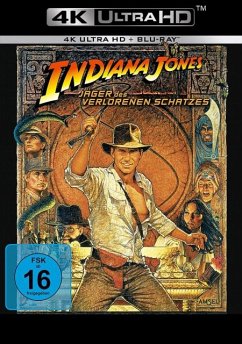


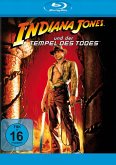





 FSK: Freigegeben ab 16 Jahren gemäß §14 JuSchG
FSK: Freigegeben ab 16 Jahren gemäß §14 JuSchG