
Mehr Güte als guttut, wilde Wut und französische Contenance - mit Filmen von Lone Scherfig, Nora Fingscheidt, François Ozon und Wang Quan'an hat die 69. Berlinale begonnen
Die Berlinale begann dieses Jahr eindeutig: gut. "Gut" jedenfalls ganz sicher im Sinne von: gütig, liebenswürdig, gut als Übersetzung des englischen "kind". "The Kindness of Strangers" hieß der Eröffnungsfilm. Warum fanden die meisten Kritiken gerade dessen Güte schlecht? Dazu gleich.
Schon vorher gab es nämlich noch eine andere gute Nachricht: Zum ersten Mal kommen, das wurde auch auf dem roten Teppich oft wiederholt, mehr als vierzig Prozent (sieben von siebzehn) der Wettbewerbsfilme von Frauen. "Finden Sie das gut, ist das wichtig für Sie?", wurde dort bei der Eröffnung immer wieder gefragt. Die diesjährige Jurypräsidentin Juliette Binoche gab die beste Antwort: "Das ist wichtig, denke ich - nicht nur für mich."
Der Film ist männlich, das Festival ist sächlich, die Berlinale aber ist weiblich: Natürlich ist das gut. Sind die Filme es auch? Sie sind bisher jedenfalls sehr, sehr gegenwärtig, sie fühlen sich nach Aufbruch an. Dazu passt auch, dass das Festival mit einem Abschiedsständchen für Dieter Kosslick begann, und daran ändert auch nichts, dass es jetzt zwischendurch immer mal zurückblickt, um seine 18 Jahre als Festivaldirektor zu würdigen.
"Wir müssen los, es ist Zeit!" So beginnt der Eröffnungsfilm "The Kindness of Strangers", den man vielleicht tatsächlich nur dann richtig mögen kann, wenn man auch die Symbolkraft dieser ersten Szene mag. "Psst", setzt die Hauptfigur Clara (Zoe Kazan) noch hinterher: Schließlich flieht sie mit ihren beiden kleinen Söhnen heimlich, im Morgengrauen, vor dem gewalttätigen Ehemann in Buffalo nach New York City. "Wir müssen los, weg von ihm, es ist Zeit", das lässt sich, nach #MeToo, eben auch als Aufbruch des Kinos, weg von Weinstein & Co. verstehen. Im Eröffnungsfilm eines großen Festivals, dem Film einer Frau über eine misshandelte Frau, erst recht. Das heißt nicht, dass Lone Scherfig (die 2001 einen Silbernen Bären mit "Italienisch für Anfänger" bekam) es auf diese Bedeutung angelegt hätte. Wobei sie bei der Pressekonferenz sagte: "Jetzt, wo ich schon neun Spielfilme hinter mir habe, dachte ich, ich könnte mich darin mal auf etwas konzentrieren, das wirklich dringend ist."
Auch die Situation von Clara im Film ist dringend. Für New York hat sie sich entschieden, weil die Stadt so groß sei, "dass er uns hier niemals wiederfinden kann", erklärt sie den Kindern. Als der ältere, Anthony (Jack Fulton), sie fragt, wo sie dort zur Schule gehen werden, sagt sie: "Die Stadt wird eure Schule sein!" Es ist dieser märchenhafte und, ja, etwas plakative Optimismus, zusammen mit den wundersam guten Schicksalswendungen, der dem Film zum Vorwurf gemacht wurde. Kann es wirklich sein, dass Clara ohne Geld, Unterkunft, Freunde oder Verwandte, nur mit der New York Public Library und der Armenspeisung als Zufluchtsorte so lange durchhält? Dass sie, als es nicht mehr geht, gerade rechtzeitig auf Alice (Andrea Riseborough), Marc (Tahar Rahim), Timofey (Bill Nighy) und Jeff (Caleb Landry Jones) trifft, die ihr helfen werden und die einander durch die Großherzigkeit von Alice, die Krankenschwester, Suppenküchen- und Selbsthilfegruppenleiterin ist, durch das russische Restaurant "Winter Palace" und natürlich durch glückliche Fügung kennen?
Der Film neigt, vor allem in der zweiten Hälfte, zu einfachen, immer hastigeren Lösungen, die auf dem Weg zum näher rückenden Happy End nun schnellstens gefunden werden müssen. Und ja, der Vater ist als durch und durch böser Mensch eine eher eindimensionale Figur. Für ihn interessiert sich der Film einfach nicht besonders. Doch erstens geht es in der Geschichte zwischendurch schon deutlich rauher zu als in einem Film, der sich das mit dem Gutfühloptimismus allzu leicht machen würde. Claras jüngerer Sohn (Finlay Wojtak-Hissong) zum Beispiel ist ernsthaft traumatisiert und erholt sich davon nicht mal zuliebe eines bereits nahenden Filmendes. Zweitens sind die Schauspieler (Zoe Kazan, Bill Nighy, Andrea Riseborough) solche, von denen man sich sehr gern vom Märchenglauben überzeugen lässt. Außerdem, das Wichtigste: Die Fremden sind nicht nur gütig, sondern auch witzig. Da ist auf der einen Seite eine etwas klamaukige, aber gut funktionierende Situationskomik und auf der anderen eine zartere Ironie. Sie lebt vom Wissen um die Konstruiertheit der Märchenerzählung, der sie angehört. "Forgiveness this way", sagt etwa Alice, als sie den Teilnehmern ihrer Vergebungs-Therapiegruppe den Therapieraum zeigt, und der Chef des "Winter Palace" enttarnt selbst dessen folkloristische Russlandinszenierung, zusammen mit seinem eigenen Akzent.
Offensichtliche Konstruiertheit muss eine Erzählung ja nicht disqualifizieren. Im "Erdbeben in Chili" stellt Kleist genau solche konstruierten Zufälle aus. Und überhaupt: Seit wann ist ungenügender Realismus bei einem Festivaleröffnungsfilm ein gültiger Vorwurf? Haben misshandelte Frauen etwa kein Recht auf filmische Mainstream-Märchenbehandlung, nur weil die Welt sie jetzt gerade als relevantes Problem entdeckt hat?
Wem das dennoch zu viel war mit der Güte, für den gibt es im zweiten Wettbewerbsfilm jede Menge Rebellion. "Systemsprenger", das Debüt der 35-jährigen Nora Fingscheidt, erzählt von dem Mädchen Benni (Helena Zengel), das regelmäßig gewaltsam ausrastet. Als Baby wurde die inzwischen Neunjährige mit einem Kissen fast erstickt, seitdem erträgt sie keine Berührungen im Gesicht. Aber auch andere Dinge machen sie unkontrollierbar aggressiv: Wo andere Kinder vielleicht weinen würden, schlägt Benni gegen Glasscheiben, andere Kinder und den eigenen Kopf. Wegen dieser Wut darf sie nicht mehr bei ihrer Mutter leben; weil sie nicht bei der Mutter lebt und weil die auch zu den Besuchsterminen eher selten erscheint, fehlt es ihr an Zuwendung, und das verstärkt die Wut. Aus 27 Heimen ist Benni inzwischen geflogen.
Die junge Hauptdarstellerin Helena Zengel spielt das Mädchen mit unheimlicher Intensität und Glaubwürdigkeit. Auch die Nebendarsteller (Albrecht Schuch als Schulbegleiter, Gabriela Maria Schmeide als Sozialarbeiterin) beeindrucken so sehr, dass man sie für Laiendarsteller halten könnte, die ihre jeweiligen Berufe tatsächlich ausüben. Und diesen zärtlich-ernst-komischen Realismus, mit dem der Film jede verletzte Geste, jeden hoffnungsvollen Satz zugleich völlig neu und absolut selbstverständlich wirken lässt, will man in den nächsten Filmen der Regisseurin bitte unbedingt immer weiter sehen. Zwischen Benni und ihrem Schulbegleiter Micha (Schuch) gibt es einige Szenen, die sich der Erinnerung schon jetzt als berührendste Beziehungsmomente dieser Berlinale anbieten. Dass Bennis Ausraster ein paarmal zu oft wiederholt werden, ohne dass sich daraus thematisch oder stilistisch etwas Neues ergäbe, ändert daran kaum etwas. Die pink-marmorierten Farbmuster, die ihr inneres Wuterleben bebildern, stören schon eher, denn sie zeigen nichts, das in Zengels Spiel nicht ohnehin bereits spürbar wäre, und unterbrechen dafür die Nähe in der Erzählung. Andererseits: Wo soll man so etwas ausprobieren, wenn nicht im Debütfilm? Großartig ist er ja trotzdem geworden.
Benni ist übrigens schon das zweite Kind im Wettbewerb, das beinahe erfriert. Obwohl es dieses Jahr am Potsdamer Platz ungewöhnlich warm ist, wird man das Mädchen zur Sicherheit mal die ganze Berlinale lang weiter mit sich herumtragen. Sie könnte es wärmen, und man selbst hat statt der Berlinale-Tasche eine portable Wut dabei.
Der Kontrast könnte zu François Ozons "Grâce à Dieu", dem dritten Wettbewerbsbeitrag, erst einmal kaum größer sein: Wo "Systemsprenger" schrie, ist dieser Film leise, französische Contenance ersetzt wilde Wut. Extrem zurückgenommen erzählt "Grâce à Dieu" ("Gott sei Dank") die wahre Geschichte des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche von Lyon in den achtziger und neunziger Jahren. Er ist so aktuell wie nur möglich. In Frankreich läuft der Prozess gerade noch, der Abspann sagt, das Urteil werde am 7. März gesprochen. Mit Hinweis auf das laufende Verfahren wird dort auch gerade versucht, den Filmstart zu verhindern.
Die Geschichte folgt drei Männern, die sich nach mehr als zwanzig Jahren wieder an den Missbrauch in der Kindheit erinnern: Alexandre (Melvil Poupaud), François (Denis Ménochet) und Gilles (Swann Arlaud). Alle drei wurden von Priester Preynat missbraucht, der als Leiter der Pfadfinder auch jeden Sommer viel Zeit mit ihnen verbrachte. Die wichtigste und überzeugendste Entscheidung des Films ist, die Geschichte so zu erzählen, dass Preynat gar nicht als schlimmster Täter erscheint. Er gibt ja von Anfang an alles zu und sagt sogar, er habe seinen Vorgesetzten doch von seinem "Problem" mit den Jungen erzählt. Die Wut des Publikums wird vor allem auf diejenigen in der katholischen Kirche gerichtet, die die Missbrauchsfälle systematisch verschwiegen haben. Erzählerisch setzt der Film damit um, worum es auch den Protagonisten geht, wenn sie die Klage auf einen Kardinal ausweiten, der Preynat hartnäckig deckte.
"Grâce à Dieu" ist auch zu Ozons bisherigen Filmen ein Kontrast: Jede Spur schwärmerischer Exzentrik ist dokumentarischem Ernst gewichen. Die Schwere des Films, die nur manchmal ins Schwerfällige kippt, entspricht dem Gewicht der Geschichte, auf die sie sich stützt.
Was für eine Befreiung aber, wenn sich danach im mongolischen Film "Öndög" von Wang Quan'an die Leinwand zum ersten Mal ganz weit öffnet. Der Himmel über der Steppe leuchtet gelb, blau und rot, und sogar die Untertitel fügen sich in das Leinwandgemälde ein. "Öndög" ist aber nicht nur Lichtkunst, es ist auch eine Art Krimikomödie: Wang Quan'an, der 2007 für "Tuyas Hochzeit" den Goldenen Bären gewann, lässt den Film mit dem Fund einer Frauenleiche beginnen. Wichtig ist sie vor allem dafür, die Hirtin (Dulamjav Enkhtaivan) und den jungen Polizisten (Norovsambuu Batmunkh) eine Nacht lang in der Steppe zusammenzubringen. Ein wenig erinnert der Film an "Fargo" der Coen-Brüder, mongolisch-poetisch neu interpretiert.
Im Eröffnungsfilm führte der Aufbruch im Morgengrauen weg vom gewalttätigen Mann, mit "Öndög" geht er jetzt hin zum großen Kino.
JULIA DETTKE
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

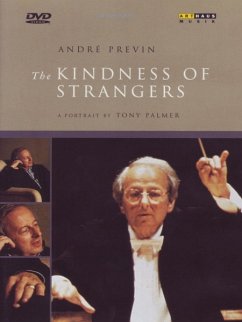

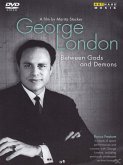
 FSK: ohne Alterseinschränkung gemäß §14 JuSchG
FSK: ohne Alterseinschränkung gemäß §14 JuSchG