Technische Angaben:
Bildformat: 2.35:1 anamorph
Sprachen / Tonformate: Deutsch, Englisch (Dolby Digital 5.1)
Untertitel: Deutsch
Ländercode:2Extras: Making of u. a.
Ein kleiner Junge wird zum neuen Dalai Lama ausgerufen - dem geistigen Oberhaupt Tibets. Doch dann besetzen die Chinesen das Land. Krieg, Folter und Verschleppung bedrohen sein Leben. Wird es ihm gelingen, sich und sein Volk zu retten? Die abenteuerliche Flucht in das Exil ist der einzige Ausweg aus der Gefahr.
Bildformat: 2.35:1 anamorph
Sprachen / Tonformate: Deutsch, Englisch (Dolby Digital 5.1)
Untertitel: Deutsch
Ländercode:2Extras: Making of u. a.
Ein kleiner Junge wird zum neuen Dalai Lama ausgerufen - dem geistigen Oberhaupt Tibets. Doch dann besetzen die Chinesen das Land. Krieg, Folter und Verschleppung bedrohen sein Leben. Wird es ihm gelingen, sich und sein Volk zu retten? Die abenteuerliche Flucht in das Exil ist der einzige Ausweg aus der Gefahr.
Bonusmaterial
Beil.: Booklet
"Kundun" oder vom Alltag des Heiligen: Martin Scorsese verfilmt das Leben des Dalai Lama
In seiner Verfilmung des Romans "Die Zeit der Unschuld" von Edith Wharton arbeitet Martin Scorsese mit einer Erzählerin im Off. Joanne Woodward erläutert die Rituale der New Yorker Spitzen der Gesellschaft in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, die dem Uneingeweihten widersinnig erscheinen; so ist es verpönt, pünktlich in der Oper zu erscheinen. Der Effekt ist Ironie: Indem der Kommentar die Regeln enthüllt, nach denen das soziale Ballett choreographiert ist, hält er den bunten Wirbel gleichsam an; die starren Konventionen, die der Verstand begreift, stößt das Gefühl fort. "Kundun", Scorseses Film über das Leben des Dalai Lama, verzichtet nicht nur auf einen Erzähler, sondern auf jede explizite Erklärung des Gezeigten. Der Zuschauer hat keinen Stellvertreter, der vom Fremdling zum Wissenden wird, wie Brad Pitt als Heinrich Harrer in Jean-acques Annauds Verfilmung der "Sieben Jahre in Tibet". Läßt sich die archaische Kultur Tibets mit einer Art anthropologischer Intuition verstehen, reichen ihre Verrichtungen in die Tiefenregionen einer menschheitlichen Erinnerung hinab, die das oberflächliche Oberschichttreiben der Wharton-Welt nicht berührte? Oder wäre jede Übersetzung eine Zurichtung und Vereinnahmung, ein Akt jener Gewalt, welche die buddhistischen Mönche in ihren endlosen Meditationsübungen zu zerstreuen suchen?
Tibet war ein Land, das keinem Fremden den Zutritt gestatten wollte. Die Briten mußten eine Armee schicken, um diplomatische Beziehungen durchzusetzen; die Tibeter hielten gleichwohl an der Fiktion fest, die Gesandten seien Gäste. Scorsese hat diese selige Selbstbezüglichkeit nicht eigentlich respektiert, denn die chinesische Eroberung hat ihre Bedingungen zerstört, als vielmehr im Reich des Ästhetischen restauriert. Der Dalai Lama und sein Volk sind heute dazu verdammt, die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zu lenken. "Kundun" ist auch ein politisches Ereignis. Das Drehbuch von Melissa Mathison ist das Resultat vieler Gespräche mit dem Dalai Lama; einige seiner Verwandten sind unter den Laiendarstellern, die Scorsese bei den Dreharbeiten in Marokko ausschließlich eingesetzt hat. Es dürfte historisch einmalig sein, daß eine Exilregierung der Weltöffentlichkeit ihre Sache in dieser indirekten, geradezu antipropagandistischen Rhetorik präsentiert: Den Anspruch auf Selbständigkeit vertritt die Autonomie des rätselhaften Kunstwerks.
Kritiker haben den Film jener Welle der Tibet-Verehrung im Schaugewerbe zugeschlagen, die geistlichen Trost in einer materialistischen Umwelt verspricht. Aber das Bedürfnis nach Identifikation weist er auch dort ab, wo die Selbstzeugnisse des Dalai Lama ihm hätten entgegenkommen können. Er hat beschrieben, wie einsam er im Potala-Palast in Lhasa war, wo selbst seine Mutter ihn als "Kundun" anreden mußte, was als "Gegenwart des Buddha" übersetzt wird. Die Unterweisung in der Glaubenslehre, in der sich sein Unterricht erschöpfte, will er als einschüchternd, die Zeremonien, aus denen sein ganzer Tag bestand, als einschläfernd empfunden haben. Das ist nicht weiter verwunderlich, macht aber westlichen Bewunderern eine Empathie leicht, die auf einem Mißverständnis beruhen mag.
Die christliche Tradition ist gemäß ihrer Trennung von Transzendenz und Immanenz geneigt, den Sinn von Ritualen in einem Jenseits zu suchen, auf das diese nur verweisen, arbiträr wie auch jedes sprachliche Zeichen. Niemand rezensiert "Kundun", ohne zu erwähnen, daß Martin Scorsese Meßdiener war und Priester werden wollte. Es bezeichnet aber die Disziplin dieses Regisseurs, daß er auf jene Gleichsetzung von Christentum und Buddhismus im Geiste eines Projekts Weltethos verzichtet hat, die mancher im Rückblick auf Scorseses Jakobskampf mit seinem katholischen Schutzengel vielleicht erwartet hatte. Die spiritualistische Deutung des Buddhismus, zu der es Sinnsucher mit christlichem Ausgangspunkt drängt, muß die ewig wiederkehrenden Gebetssitzungen als Exerzitien der Vergeblichkeit deuten, als Demonstration der Unmöglichkeit, das Heilige in Formeln zu fassen. Hätte aber dieser Beweis nicht auch von einem einzigen Kloster geführt werden können, dessen Mönche mit dem Opfer des dauerhaften Gebets allen anderen Tibetern erlaubt hätten, ihr Heil in der Säkularisierung zu suchen?
Die gesamte Volkswirtschaft Tibets war auf den Unterhalt der riesigen Klosterkomplexe ausgerichtet; die Erhaltung der Religion war das einzige Gebot der Staatsräson. Scorsese stellt eine Lebensform vor unser Auge, in der himmlische und irdische Dinge nicht getrennt waren, auch Dogma und Ethik nicht. Die Regierung befragt vor jeder wichtigen Entscheidung das Staatsorakel. Das Medium trägt einen drückend schweren Kopfputz und wird durch Musik in Trance versetzt. Die Gottheit spricht in Zischlauten; Mönche übersetzen. In jedem vom Film dokumentierten Fall ist auf die Gottheit Verlaß; als der Dalai Lama 1959 aus Lhasa flieht, gibt das Orakel den sicheren Weg an. Der westlich aufgeklärte Blick wird Priestertrug argwöhnen; der Film enttäuscht das rationalistische Mißtrauen ebenso wie die sentimentale Zutraulichkeit. Der kleine Junge auf dem großen Thron wird nicht als unglücklich geschildert - aber auch nicht als glücklich.
Mit den Augen des Bauernjungen, der 1937 als vierzehnte Reinkarnation des Dalai Lama erkannt wurde, sieht der Zuschauer die Schritte des als Diener verkleideten Lamas, der ihn sucht, und danach die ganze Geschichte. Das Rätsel, das der Ritus für den Zuschauer bleibt, löst sich für den Dalai Lama, den vier verschiedene Darsteller vertreten, allmählich auf, ohne daß der Zuschauer diesen Bildungsroman entziffern könnte. Auch die anderen Figuren werden nicht zu Individuen im Sinne der westlichen literarischen Tradition, die aus der Welt heraustreten und Objekte der Anteilnahme oder des Urteils werden könnten. Statt der kontinuierlichen Entwicklung einer Handlung gibt es eine Folge von Tableaus. So hat der Dalai Lama, bevor er für mündig erklärt wurde, nur in einzelnen Bildern gesehen, was um ihn herum geschah: Im Film ist er Zeuge der Geste der Verneigung, mit der der junge Regent Reting sein Amt an den alten Taktra übergibt; von dem Machtkampf hinter den Kulissen weiß er nichts. Er sieht Reting erst wieder, als er als Gefangener nach Lhasa gebracht wird.
Seine Helden seien auf der Suche nach Gnade und würden von der Normalität in Versuchung geführt, hat Scorsese gelegentlich bemerkt. Dem Dalai Lama bieten erst die chinesischen Invasoren die Chance, ins normale Leben überzutreten. "Religion ist Gift", erklärt ihm Mao und verlockt ihn, seine Rolle im Geist zu verlassen, der Welt objektiv gegenüberzutreten und das Gute unter dem Gesichtspunkt der Nützlichkeit zu betrachten. Scorseses Christus in der Katzantzakis-Verfilmung siegt über seine letzte Versuchung, als er den Willen beweist, am Kreuz zu sterben. Man könnte die zweite Hälfte von "Kundun", von der Invasion der Chinesen bis zur Flucht des Dalai Lama acht Jahre später, für eine Passion halten. Aber das Ideal, das im Dalai Lama menschliche Gestalt annimmt, ist eine andere Liebe als der prometheische Heroismus Christi: Nicht die Überwindung der Welt im Willen ist an ihm vorbildlich, sondern die Willenslosigkeit. Zur Ethik der Gewaltlosigkeit, von der Martin Scorsese ein Bild gibt, das sich ohne Worte verstehen soll, gehört nicht nur der Verzicht auf die Gewalt gegen andere, den auch Jesus gelehrt hat. Dem Mitleid mit allen Kreaturen widerspricht auch die Gewalt gegen sich selbst, die man das Opfer nennt. Der westliche Mensch ist stolz, weil er sich wehtun kann. Erst die Kommunisten haben den Dalai Lama gezwungen, ein solches Individuum zu werden. PATRICK BAHNERS
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

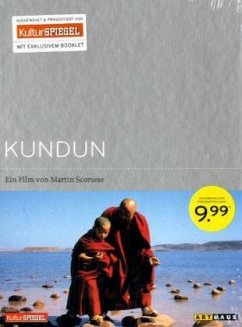


 FSK: Freigegeben ab 6 Jahren gemäß §14 JuSchG
FSK: Freigegeben ab 6 Jahren gemäß §14 JuSchG