Der alte Weinhändler Bockelmann war schon immer ein grantiger, kauziger Kerl, nie hat er sich um seine Verwandtschaft geschert, das einzig Wichtige in seinem Leben war seine Winzerei. Und die lief immer bestens. Deshalb war die liebe Verwandtschaft auch stets bemüht, sich gut zu stellen mit dem reichen Onkelchen, denn schließlich war ein jeder scharf auf eine satte Erbschaft, sollte der alte Bockelmann das Zeitliche segnen. Eines Tages ist es dann auch soweit. Bockelmann stirbt, und die ganze Sippschaft reist an, um gespannt der Verkündung des Testaments zu lauschen. Die Empörung ist groß, als sich herausstellt, dass Bockelmanns Neffe Peter Frank, der erfolgreich und uneigennützig in der Firma seines Onkels arbeitet, als Universalerbe eingesetzt wurde. Nur eine Bedingung muss der trinkfeste Lebemann erfüllen: er darf vier Wochen lang keinen Tropfen Alkohol zu sich nehmen, sonst bekommt er gar nichts. In dieser Klausel sehen die gierigen Verwandten ihre Chance. Kein noch so verrückter Versuch wird ausgelassen, um Frank doch noch ein Schlückchen einzutrichtern.
Bonusmaterial
DVD-Ausstattung / Bonusmaterial: - Kapitel- / Szenenanwahl - Animiertes DVD-Menü - Fotogalerie
Max Ophüls hat in Deutschland zwischen 1931 und 1933, bevor er vor den Nazis nach Paris und Hollywood floh, fünf Filme gedreht. Einer ist verschollen. In einem anderen spielt Heinz Rühmann mit, deswegen gibt es ihn auf DVD. Den Rest nicht. Plädoyer für eine vollständige Ophüls-Edition.
Von Verena Lueken
Es ist fast zehn Jahre her, dass Max Ophüls hundert Jahre alt geworden wäre. Was einen schönen Anlass abgegeben hätte, sein Werk, das nur zwanzig Filme umfasst, nach den nötigen umfangreichen Restaurierungsarbeiten, dem Wiederherstellen verstümmelter Versionen und einer vollständigen Retrospektive in allen deutschen, französischen und amerikanischen Filmmuseen in eine DVD-Box zu packen.
Das ist damals nicht geschehen. Und seitdem auch nicht. Und so gibt es heute zwar eine wunderbar restaurierte und kommentierte "Lola Montez" und den einen oder anderen Film aus Ophüls' Zeit in Frankreich und den Vereinigten Staaten in unterschiedlichem Zustand und in unterschiedlicher Ausstattung auf DVD. Aber die deutschen nicht.
Der Konjunktiv scheint der passende Modus, um sich diesen frühen Filmen zu nähern, die zwischen 1931 und 1933 in Berlin entstanden, bevor Ophüls auf der Flucht vor den Nazis nach Paris und von dort im Zickzackkurs nach Hollywood emigrierte. Denn man könnte, es sind ja nur vier (der fünfte, sein erster, ist verschollen), wenn sie besser erhalten wären, möglicherweise Fluchtlinien von ihnen zu seinem späteren Werk ziehen - Fluchtlinien, die mehr wären als eine Ahnung. Und man könnte, wenn diese vier Filme von der Filmwissenschaft im Kontext der deutschen Filmproduktion jener Jahre plaziert würden, etwas darüber erfahren, was aus dem deutschen Kino hätte werden können, wenn nicht die Nazis das Land und die Unterhaltungsindustrie und die Kunstproduktion überhaupt sich einverleibt hätten. Und müsste dabei nicht immer nur von Fritz Lang e tutti quanti reden. Man könnte eine Vorstellung davon entwickeln, was aus dem deutschen Kino später hätte werden können, wenn die deutschen Regisseure in Oberhausen sich auf eine weitgefächerte Tradition vor der nationalsozialistischen Machtübernahme besonnen hätten und wenn Fassbinder nach Douglas Sirk, einem weiteren Emigranten aus Nazi-Deutschland, auch auf Ophüls gestoßen wäre, was nur sein früher Tod verhinderte. Lauter "wäre", "könnte", "hätte" also im Fall Ophüls. Vor allem bei den frühen Filmen.
Wer sie sehen will, ist auf VHS-Kassetten im besten Fall oder auf Mitschnitte von lange zurückliegenden Fernsehausstrahlungen angewiesen, bei denen der Ton knattert, das Bild wackelt und über die Szenen, auch jene, in denen die Sonne scheint, ein graues Schneetreiben niedergeht. Der erste Film, den Ophüls nach einigen Jahren als Schauspieler und schließlich als Regisseur an verschiedenen Theatern zwischen Aachen und Wien (wo er gekündigt wird, weil er Jude ist) dreht, ist ganz verschollen. "Dann schon lieber Lebertran" entstand bei der Ufa im Jahr 1931. Es war die Verfilmung einer kurzen Skizze von Erich Kästner, und Ophüls erinnert sich in seinen autobiographischen Aufzeichnungen ("Spiel im Dasein". Eine Rückblende. 1959), wie er sie aus einem Stapel von Manuskripten gezogen hatte, die bei der Ufa in der Berliner Krausestraße in einem vollgepfropften riesigen Bücherregal auf einen wie ihn warteten. "Man hatte mir erlaubt, eine Geschichte nach meinem Geschmack herauszusuchen." Er traf Billy Wilder dort, der auf ihn wirkte wie "ein Steptänzer", sehr gut gelaunt war und ihn ansprach. "Ich fand auf zwei Seiten ein Dichtwerk", schreibt Ophüls.
Man muss sich das vorstellen. Billy Wilder, der ja tatsächlich einmal im Eden-Hotel als Eintänzer sein Geld verdient hatte, vier Jahre jünger war als Ophüls und sich noch Billie schrieb, hatte bereits bei "Menschen am Sonntag" (1930) mitgemacht und schrieb in rasantem Tempo Drehbücher und Drehbuchideen auf, elf insgesamt zwischen 1929 und 1933, dem Zeitpunkt seiner Emigration. Er war, mit einer Nennung als Autor beim "Teufelsreporter" und den "Menschen am Sonntag", im Vergleich zu Ophüls ein alter Hase im Filmgeschäft. Er sagt zu dem Neuen: "Sie werden schon finden, was Sie suchen", und der Neue findet "Dann schon lieber Lebertran". Etwa zur selben Zeit muss Wilder an der Drehbuchfassung von Kästners "Emil und Detektive" gearbeitet haben; Gerhard Lamprecht drehte diese erste Verfilmung des Kinderbuchs ebenfalls 1931. Sieben weitere folgten in Produktionen rund um den Globus in den nächsten siebzig Jahren. In Hollywood, in der Emigration, haben Ophüls und Wilder sich wiedergetroffen. Aber es wurde keine Freundschaft daraus. Ophüls hielt sich lieber an weniger gutgelaunte Vertriebene, an Peter Lorre, Conrad Veidt oder Kurt Weill.
Die beiden Seiten, die Ophüls aus dem Manuskriptberg bei der Ufa fischte, sind bisher nirgendwo wiederaufgetaucht. Aufgetaucht aber ist das Drehbuch, das Erich Kästner und Emmerich Pressburger (der später nach London emigrierte und mit Michael Powell unter vielen wundervollen Filme etwa "Die roten Schuhe" und "Peeping Tom" drehte und der keineswegs vergessen ist) daraus gemacht haben. Die Zeitschrift "Filmexil" hat es 1993 abgedruckt, und es beginnt so: "Freiaufnahme: Bild 1.Totale: Wolkenbild. Ganz leise hört man das Lied der Wolgaschlepper. Bild 2. Halbtotale: Über den blauen, sonnig strahlenden Himmel zieht eine weiße, schöne Wolke. Bild 3. Fahraufnahme: Der Apparat geht auf die Wolke zu. In der Nähe gesehen stellt sich das Ziehen der Wolke allerdings als ein Irrtum heraus. Bild 4. Gross: Die Wolke, jetzt deutlich sichtbar, ist eine in der himmlischen Werkstatt angefertigte Requisite. - Die Wolke zieht nicht." Sie wird gezogen, und zwar von einer Engelschar. Das sind die ersten Meter Film, die Ophüls inszeniert hat. Eine Täuschung. Ein Spiel mit dem Publikum. Ein Hinweis aufs Medium. Eine Kamerafahrt.
Ophüls aber sah erst einmal nur den Himmel. "Ich kannte", erinnert er sich, "bisher Himmel nur auf einer kleinen Kulisse gemalt. Das war der richtige Himmel. Als ich ihn sah, hatte ich das Gefühl, der, in den ich einst kommen werde, kann nur kleiner sein." Sein erster Kameramann hieß Eugen Schüfftan, der schon für Fritz Lang bei den "Nibelungen" (1924) und "Metropolis" (1927) und bei Robert Siodmaks "Menschen am Sonntag" die Kamera geführt hatte und sehr viel später für Robert Rossens "Haie der Großstadt" (1961) einen Oscar gewinnen sollte. In Hollywood war Schüfftan später der Nachbar von Ophüls, und sie begrüßten einander immer freundlich. In Berlin, aus dem sie beide fliehen mussten, bewahrte der Erfahrenere den Anfänger vor der einen oder anderen Blamage. Wenn die Klappe geschlagen worden sei, erklärte er dem Debütanten damals, dürfe dieser nicht mehr mit den Schauspielern reden, sonst komme das in den Film. Wenn es doch passierte, ließ er die Kamera einfach nicht laufen.
Es geht in diesem Kurzfilm mit der Zensurlänge von 605 Metern darum, dass die Kinder für einen Tag mit ihren Eltern die Rollen tauschen, weil sie es leid sind, wie ständig an ihnen herumgenörgelt wird und dass sie der Gesundheit zuliebe vor dem Einschlafen Lebertran trinken müssen. "Dann schon lieber Lebertran" ist ihre Antwort auf die Welt, in der sie einen Tag lang erwachsen waren. Ophüls spürte, als er seinen Film sah, dass er sich in die Kamera verliebt hatte: "Die Kamera schleppte mich nur so fort, wie eine Geliebte einen verheirateten Mann ablenkt von der Ehefrau." Die Ehefrau, das war bis dahin der Text gewesen. Den strich er von nun an, so gut es ging, weg.
Der erste Ophüls-Film, den wir tatsächlich sehen können, ist "Die verliebte Firma" von 1931. Eine Geschichte aus der Filmwelt, die Ophüls gerade erst kennenlernte. Und schon eine Parodie auf die Eitelkeiten, Selbstbezüglichkeiten, auf die Verführungskraft von Ruhmesversprechen, die Wichtigtuereien im Herstellungsprozess. Ein Paar in Abendkleidung steht im Schnee. So fängt der Film an. Der Mann im Frack, die Frau im Abendkleid, sehr luftig, prosten sich zu. Und singen von Venedig. "Sehr gut, noch mal", sagt der Regisseur. Sie machen es noch siebenmal genauso. Beim achten Mal fährt ein Mädchen auf Skiern durchs Bild. Beim neunten ist die Sonne weg. Der Regisseur flucht, das Paar beginnt zu streiten, das Gerät wird zusammengepackt, die Szene vertagt. Das Paar, das auch privat eines ist, trennt sich. Das junge Mädchen mit den Skiern, das bei der Post arbeitet und Gretl Krummbichler heißt, taucht wieder auf. Wäre das nicht ein herrliches neues Gesicht? Haben nicht alle die Nase voll von der Diva? Braucht ihr Mann nicht eine neue Partnerin? Alle fahren aus den Bergen zurück nach Berlin, Gretl im Schlepptau. Alle haben versprochen, für ein Rendezvous mit ihr aus Gretl von der Post einen Weltstar zu machen. Alle, außer dem Produzenten, der keinen Star in ihr sieht, sondern eine Hausfrau. Und der sie heiraten wird, und zwar in Venedig.
Was für ein böses Ende für einen Film, den der Rhythmus der Schlager, die im Film erst komponiert und geprobt und im Film im Film dann gesungen werden, vorantreibt (oder immer wieder auch auf der Stelle treten lässt)! Schon im ersten Film, den wir von ihm sehen können, löst Ophüls die Regeln auf. Treibt ein Spiel im Spiel. Macht das Kino zum Thema, in der Geschichte wie in den Songs: "Ich wär' so gern mal richtig verliebt, ich weiß vom Tonfilm, dass es das gibt" - so dichten und komponieren die Songschreiber für den Film, den die Firma drehen will und von dem wir nicht ganz sicher sein können, ob ihr das auch gelingt. Sehen wir hier schon, was aus Ophüls einmal werden würde? Manches wirkt noch etwas schwerfällig, was aber auch an der lausigen Kopie liegen kann, auf der die Bilder manchmal unzulässig und gar nicht leichtfüßig zu hüpfen scheinen, wie in der Szene in einem Wellenbad, in dem sich unverabredet die ganze Filmmannschaft trifft, weil Gretl hier zum Schwimmen gegangen ist. Allerdings mit dem Produzenten. Aber dann gibt es da schon die Türen, die sich nacheinander öffnen, wenn Gretl von einem zum anderen schlendert, um sich instruieren zu lassen, wie das so geht beim Film - was den Eindruck eines endlosen Raums schafft, in dem die Möglichkeiten des Lebens nacheinander aufgereiht sind, ironisch, versteht sich, denn es handelt sich um eine Filmfirma und die Möglichkeiten sind letztlich immer dieselben: Aufstieg und Abstieg.
Es war Frieda Grafe, die darauf hingewiesen hat, viele Filme von Ophüls hätten zwei Enden: eines für die Geschichte und eines für den Film. Schon in der "Verliebten Firma" ist das so. Am Ende sitzt Gretl, gespielt von Lien Deyers, im Zug nach Hause. Die Kamera schwenkt über ihr trauriges Gesicht hinaus, blickt über die Menschen im Bahnhof hinweg auf den Verkehr der Straßen und verweilt dort lang. Gretl ist allein, gescheitert. Damit ist der Film zu Ende. Und dann: das Ende der Geschichte. Der Produzent (Gustav Fröhlich) betritt das Abteil. Mit Fahrkarten nach Venedig. Gretl wird in Zukunft Schnitzel braten für diesen Mann. Das hätte sie auch mit dem Postvorsteher in ihrem Dorf haben können. Jetzt ist auch die Geschichte zu ihrem Schluss gekommen.
Im nächsten Film, der "Verkauften Braut", die 1932 in Geiselgasteig bei München entstand, geht Ophüls aufs Ganze, das heißt: auf den Jahrmarkt. Er reiste durch ganz Deutschland, um Schausteller, Zirkusleute, Wahrsager, einen falschen Indianer, einen Tanzbären und Karl Valentin mit Liesl Karlstadt zu engagieren und sie in einem im Freien gebauten "tschechischen Dorf" ihre Zelte aufschlagen zu lassen. Die Hürde, die man heute nehmen muss, um in diesen Film zu kommen, ist die Musik von Smetana, dessen Oper desselben Titels Ophüls ausgeschlachtet und nur die kreischendsten Ohrwürmer übrig gelassen hat. "Alles ist so gut wie richtig" - Otto Wernicke (in der Rolle des Kupplers Kezal) hört gar nicht mehr auf, diesen Refrain zu singen, der erst am Ende, wenn sich über Kreuz die richtigen Paare gefunden haben, seine Berechtigung hat. Marie, die den reichsten Mann der Gegend heiraten sollte, kriegt ihren Postillion. Und der reichste Mann heiratet die Tochter des Zirkusdirektors Karl Valentin. Der sorgt dann auch für einige unvergessliche Augenblicke, alle improvisiert, wie Ophüls betont. "Wie viele Angestellte haben Sie?", fragt der Steuereintreiber. "Ja, fast acht", sagt Valentin nach fragendem Blick zu Liesl Karlstadt zögernd. "Fast acht? Sieben also", meint der Steuereintreiber, aber Valentin winkt heftig ab. "Sieben? Nein. So viele nicht. Eher fünf."
Trotz solcher Sketche findet Ophüls hier nicht den Witz der "Verliebten Firma" und noch nicht die Sicherheit, mit der er in "Liebelei" die Kamera bewegt. Immer wieder brechen Schwenks plötzlich ab, verläppert sich der Blick irgendwo, und das Ganze wirkt hektisch auch dann, wenn niemand in Eile ist. Selbst am Ende, wenn die Röcke beim Dorftanz fliegen und die Kamera sich im gebauschten Stoff zu verlieren scheint und mit den Tänzern herumgewirbelt wird, zerhacken Schnitte die Bewegung, die gerade in Schwung gekommen war.
Was Ophüls selbst von diesem Film hielt, lässt sich seinen Erinnerungen nicht entnehmen. Immerhin drehte er keinen Opernfilm, wie es der vermögende Präsident der "Vereinigung deutscher Lichtspieltheaterbesitzer", der das Geld dafür gab, sich vorgestellt hatte. Ophüls mochte wohl "die frische Luft", welche die Außenaufnahmen der Musik gaben. Er lernte Curt Alexander, den Drehbuchautor kennen, mit dem er seitdem eng befreundet war. Und er liefert die schönste, wahrste, komischste Anekdote zum Film: Er führte ihn nämlich, bevor irgendjemand sonst ihn zu sehen bekam, Karl Valentin vor. Nun war am Ende der Dreharbeiten Liesl Karlstadt, die Valentin nur "das Fräulein" nannte, schwer erkrankt, und die letzte ihrer Szenen musste mit einem Double gedreht werden. Valentin sitzt also in der Vorführung, und als sie zu Ende ist, blickt er Ophüls mit tränenüberströmtem Gesicht an. "Wie hat es Ihnen gefallen?", fragt Ophüls. ",Traurig!' sagt Valentin. ,Sehr traurig! Von dem einen Bild an, wo jemand Fremdes das Fräulein war, wie mir da vor dem Karren über die Landstraß gehen, hab i weinen müssen I hab die ganze Zeit dran gedacht, wie das Fräulein so krank war.'"
"Die lachenden Erben", den Film, der dann kam - mit haufenweise Stars wie Heinz Rühmann, Max Adalbert, Ida Wüst und wieder mit Lien Deyers 1932 gedreht, aber erst 1933 in die Kinos gebracht und der einzige jener Jahre, der auf DVD vorliegt -, mochte Ophüls selbst gar nicht. Er habe den Film nie zu Ende gesehen und würde auch kein Geld für eine Kinokarte dafür ausgeben, schreibt er im "Spiel im Dasein". Und wieder ist es eine Anekdote, mit der er erklärt, was er von diesem "mit reiner Routine gemachten" Film hält. Sie handelt von Max Liebermann, der einmal den Generalfeldmarschall von Hindenburg porträtieren sollte. "Den piß ick in den Sand", soll Liebermann gesagt haben. "Die lachenden Erben" hat Ophüls in den Sand gepisst, und ungefähr so hören sie sich an und sehen sie auch aus.
Aber dann: "Liebelei". Ausgehend von dem gleichnamigen Theaterstück von Arthur Schnitzler, schreiben Ophüls, Hans Wilhelm und Curt Alexander den Film, der dazu führte, dass die Amerikaner den Saarbrücker Max Ophüls lange für einen Wiener hielten; den Film, den Preston Sturges zu sehen kriegte und daraufhin Ophüls, jahrelang in Hollywood ohne Arbeit, bei den Studioleuten ins Gespräch brachte. Das erste Meisterwerk, wenn man so will, ist "Liebelei" der erste Film, dem man selbst in dem beklagenswerten Zustand der Aufzeichnung ansieht, wie Ophüls sich mit dem Apparat gleichsam symbiotisch verband.
Wieder steht eine Frau im Mittelpunkt, Christine, die Magda Schneider spielt wie eine schüchterne Maus, deren Sehnen und Begierde im Blickwechsel mit dem Leutnant Fritz (Wolfgang Liebeneiner) und in einem Tanz mit ihm erlöst werden. Aber Fritz hat noch ein Verhältnis mit der Frau des Barons (Olga Tschechowa mit Gustaf Gründgens), das er nicht erträgt, weil es heimlich ist, und das er gern los wäre, nachdem er Christine getroffen hat. Doch der Baron stellt ihn. Es kommt zum Duell, Fritz stirbt. Wir sehen das nicht, wir hören nur den ersten Schuss, der dem gekränkten Baron gehört, und dann den zweiten nicht mehr. Christine hat in der Oper, in der ihr Vater (Paul Hörbiger) im Orchester spielt, in der Zwischenzeit vorgesungen. "Brüderlein, Schwesterlein", herzzerreißend. Strahlend, weil sie an der Oper angenommen wurde, läuft sie zur Wohnung, die Fritz sich mit seinem Freund Theo (Willy Eichberger) teilt, der seinerseits mit Christines Freundin Mizzi (Luise Ullrich) aus- und ins Bett geht.
Die Wohnung ist leer. Fritz sagte, er müsse verreisen, kein Wunder, dass er nicht da ist. Christine hat keinen Verdacht, sie steigt auf einen Stuhl, hängt die Girlanden vom Vorabend ab, räumt auf. In der Oper probt das Orchester Beethovens Fünfte, die Schicksalssymphonie. Theo und Mizzi reißen Christines Vater aus der Probe, eilen mit ihm zur Wohnung, erzählen Christine, was geschehen ist. Sie geht aus dem Zimmer, durchquert das angrenzende, öffnet das Fenster und springt. Was wir wiederum nicht sehen. Aber wir sehen von unten nun, wie der Rahmen des Fensters nachschwingt, und wir hören, was die Liebenden sich auf einer glücklichen Kutschfahrt geschworen hatten: Ich schwöre, dass ich dich liebe - und . . . dass ich dich ewig liebe. Die Worte von Toten. Und dann streift die Kamera noch einmal kurz über den tiefverschneiten Wiener Wald, und wir erinnern uns an die Kutschfahrt der beiden über eine Lichtung, auf der die Büsche und Bäumchen unter ihrer Schneelast die Form von Kreuzen angenommen hatten, als führen die Liebenden über einen Friedhof, auf dem die Liebe, die sie sich auf ewig schwören, bereits begraben liegt.
Was wir in den späteren Filmen bewundern, die verschränkten Zeitebenen in komplexer Rückblendenstruktur, die Erinnerungsbilder - in diesen frühen Filmen finden wir sie noch nicht. Aber vieles andere ist schon da. Wie etwa diese Kutschfahrt, die der Film am Ende noch einmal ins Gedächtnis ruft. Wie die Walzer. Einmal tanzen Fritz und Christine, und die Kamera folgt ihnen durch das Tanzcafé, in dem die Musik aus einem Automaten kommt, verliert das Paar dann zwischen den Spiegeln, findet es wieder, alles ist etwas ungelenk, die beiden kennen sich kaum, halten sich zum ersten Mal im Arm. Dabei könnten sie hier, niemand schaut ihnen zu als ihre Freunde und dann nicht einmal mehr die, hier also könnten sie doch etwas Weichheit wagen, sich ineinander fallen lassen, aber ihre Bewegungen sind eckig. Auf dem Ball im Hause des Barons hingegen, auf dem Fritz mit der Baronin tanzt, dürfen sich diese beiden keinesfalls gehen lassen, sie müssen die Form und den Abstand wahren, und doch spürt man, dass sie sich ungekämmt kennen und ohne Handschuhe, und die Kamera folgt ihnen wieder, aber nun ist sie es, die Abstand hält, sich nicht mit ihrem heimlichen Verhältnis verbündet, das Fritz innerlich schon aufgekündigt hat.
In diesen Bildern weist die Kamera auf das, was kommen wird: die Trennung. Und dass sie am Schicksal der großen Liebe zwischen Fritz und Christine nichts ändern kann. Die Uraufführung in Berlin war am 16. März 1933. Ophüls, mit Frau und Sohn auf dem Weg zum Bahnhof, um das Land in Richtung Paris zu verlassen, fuhr ein paarmal mit dem Auto um das Atrium-Kino herum. Neben dem Titel "Liebelei" leuchtete dort groß sein Name.
Ophüls war kein Kinogänger. Hat er sich je substantiell über das Werk eines seiner Kollegen geäußert? Nicht aus Anschauung oder Analyse, vielmehr mit der Intuition eines genuin filmischen Genies verstand er das Kino und seine Möglichkeiten - die, als er begann, noch gar nicht ausgeschöpft waren und die er selbst später in einer großen versöhnenden Bewegung von Literatur, Musik und Jahrmarktsgeschrei austesten und erweitern würde. Er verstand sie vielleicht schon, als er zum ersten Mal einen Film sah. Das war 1906, und er ging mit seiner Großmutter in Worms auf dem Jahrmarkt in ein Zelt.
Dort sah er etwas, "was genauso lang dauerte, wie man braucht, es zu erzählen": "Ein dicker Mann mit wilden Augen war sehr aufgeregt. Er zappelte mit den Armen in der Luft, er schlug sich gegen die Brust. Er rannte auf mich zu, wie wenn er mir was tun wollte. Ich hielt mich an meiner Großmutter fest. Er tat aber nichts. Er hielt inne. Er schaute nach unten. Er sah auf einem Schreibtisch ein riesengroßes Tintenglas. Er soff es aus. Er lief von unten her langsam blau an. Er erschrak fürchterlich. Wie sein Gesicht ganz blau wurde, wurde es hell im Zelt - und der Film war zu Ende."
Ophüls war vier, als er diese Sensation erlebte. Er hieß noch Maximilian Oppenheimer - vorne Habsburg, am Ende die Atombombe, wie Anthony Lane vom "New Yorker" einmal schrieb. Er hatte sich gefürchtet, er hatte geweint, er hatte gelacht. Er hatte in diesen Minuten, in denen ein Mann blau anlief, weil er einen Liter Tinte getrunken hatte, alles erlebt, was Kino kann. Und später fügte er diesem "alles" noch etwas hinzu: die filmische Version von Erinnerung und wie sie die Zeit auflöst und das, was einmal eine gerade Linie von Chronologie war, in eine Kugel aus Rückblenden und Vergegenwärtigung vergangener Bilder formt, die sich dreht, bis der Abspann kommt. In Deutschland hatte Ophüls nicht genug Zeit, um ganz dahin zu kommen. Aber er hat sich schon mal auf den Weg gemacht.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

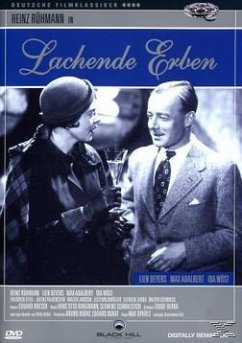
 FSK: ohne Alterseinschränkung gemäß §14 JuSchG
FSK: ohne Alterseinschränkung gemäß §14 JuSchG