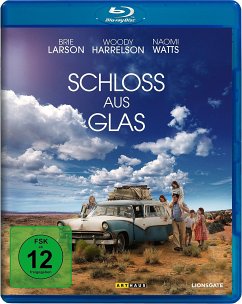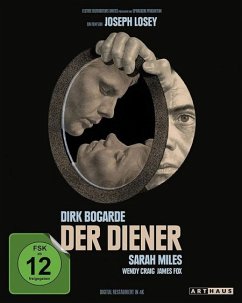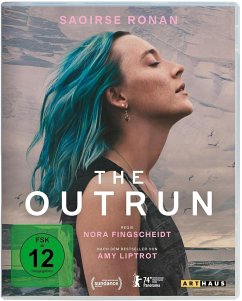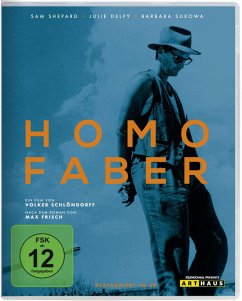Lara

PAYBACK Punkte
7 °P sammeln!
Es ist Laras sechzigster Geburtstag, und eigentlich hätte sie allen Grund zur Freude, denn ihr Sohn Viktor gibt an diesem Abend das wichtigste Klavierkonzert seiner Karriere. Schließlich war sie es, die seinen musikalischen Werdegang entworfen und forciert hat. Doch Viktor ist schon seit Wochen nicht mehr erreichbar und nichts deutet darauf hin, dass Lara bei seiner Uraufführung willkommen ist. Kurzerhand kauft sie sämtliche Restkarten und verteilt sie an jeden, dem sie an diesem Tag begegnet. Doch je mehr Lara um einen gelungenen Abend ringt, desto mehr geraten die Geschehnisse außer Kon...
Es ist Laras sechzigster Geburtstag, und eigentlich hätte sie allen Grund zur Freude, denn ihr Sohn Viktor gibt an diesem Abend das wichtigste Klavierkonzert seiner Karriere. Schließlich war sie es, die seinen musikalischen Werdegang entworfen und forciert hat. Doch Viktor ist schon seit Wochen nicht mehr erreichbar und nichts deutet darauf hin, dass Lara bei seiner Uraufführung willkommen ist. Kurzerhand kauft sie sämtliche Restkarten und verteilt sie an jeden, dem sie an diesem Tag begegnet. Doch je mehr Lara um einen gelungenen Abend ringt, desto mehr geraten die Geschehnisse außer Kontrolle.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.