Der introvertierte junge Rockmusiker Blake haust mit seinen Bandkollegen in einem entlegenen Haus. Auf der Suche nach Inspiration zu neuen Songs zieht es ihn immer wieder hinaus in die Natur. Seine Manager und Freunde versuchen, ihn noch einmal zu einer einträglichen Welttournee zu bewegen. Doch Blake lässt sich treiben... LAST DAYS ist eine hypnotisierende Hommage an Kurt Cobain. Kaum ein anderer Rockstar der 90er-Jahre hat eine gesamte Generation junger Menschen so geprägt wie der Leadsänger der US-amerikanischen Grunge-Band Nirvana. Im April 1994 nahm er sich das Leben, und bis heute kursieren die wildesten Gerüchte über seinen Tod.
Bonusmaterial
Making Of Musikvideo Trailer DeletedScene The Long Dolly Shot
Cobain tot, Kino lebt: Van Sant und Egoyan im Wettbewerb
CANNES, 13. Mai
Besseres Wetter kann man in Cannes nicht bekommen: wolkenloser Himmel, fünfundzwanzig Grad, leichter Wind vom Meer. Dennoch gibt es Filme, nach denen man ins Licht an der Croisette hinaustritt wie in einen dunklen Tunnel, Geschichten, die den hellen Mittag wie Mitternacht aussehen lassen. Eine solche Geschichte erzählt "Last Days", der neue Film des Amerikaners Gus Van Sant.
Im April 1994 erschoß sich der Lyriker und Musiker Kurt Cobain in seinem Haus in der Nähe von Seattle mit einer Schrotflinte. Mit seiner Band Nirvana war er vier Jahre lang die Sensation der amerikanischen Popmusik gewesen; sein Tod machte ihn zum Mythos. Van Sant hat für seinen Film Cobains fünf letzte Lebenstage nachgestellt, oder besser: Er hat sie ausphantasiert. Am Anfang von "Last Days" sieht man einen Mann in verdreckten Kleidern durch die Wildnis laufen. Er stolpert über Wurzeln und feuchte Steine, badet in Wasserfällen, redet wirres Zeug. Blake, so heißt der Mann, ist, wie man später erfährt, aus einer Drogenklinik ausgebrochen. In dem klotzigen grauen Haus, das er schließlich erreicht, gibt es keinen Unterschied zwischen Welt und Wahn. Ein paar Freunde und Kollegen Blakes übernachten hier wie Zugvögel auf dem Weg nach Süden; andere, darunter ein Angestellter der örtlichen Telefongesellschaft und zwei Abgesandte der Kirche der Heiligen der letzten Tage, klingeln an der Tür, aber Blake versteht nicht, was sie von ihm wollen. Er geht wie eine Puppe durch sein Leben, gefühllos, ausgepumpt, mit hängenden Gliedern und starren Augen. Aus einem Schrank holt er einen Unterrock seiner Mutter und zieht ihn an. Als ein Angestellter seiner Plattenfirma das Haus durchsucht, flüchtet er in den Wald. Irgendwann nimmt er eine Gitarre in die Hand und singt ein Lied, dessen Refrain lautet, es sei ein langer schwerer Weg vom Tod bis zur Geburt. Während ringsum alle über ihn reden, wird Blake immer stiller. Zuletzt schlurft er mit einem Gewehr in der Hand in seinen Geräteschuppen. Er kehrt nie zurück.
Der Kunstgriff, den Gus Van Sant in "Last Days" anwendet, um der Geschichte ihre heilige Banalität zu nehmen, besteht darin, daß er die Zeit in Stücke hackt. Das hat schon in "Elephant" funktioniert, für den Van Sant vor zwei Jahren die Goldene Palme bekam, und hier funktioniert es noch besser. Der Film zeigt keine Folge von Ereignissen, sondern verschiedene Ansichten derselben Sache, die einander überlagern und ergänzen wie Stimmen in einem Musikstück. Eine Dialogszene kehrt fünf Minuten später wieder, aufgenommen aus der Perspektive einer dritten Person. Ein Mädchen öffnet eine Tür, hinter der Blake zusammengebrochen ist, und kurz darauf sehen wir dasselbe noch einmal, nur durch seinen Blick. So entsteht ein Bild aus Splittern, eine jener amerikanischen Landschaften, wie sie David Hockney auf seinen aus Polaroids zusammengesetzten Fotomosaiken zeigt.
Bei Van Sant bekommt das Bild durch die zeitliche Verlaufsform eine zusätzliche tragische Dimension. Es drängt zur Katastrophe hin wie die Musik, die in "Last Days" gespielt wird und die fast nur von Trauer und Todessehnsucht erzählt. Beides, der Selbstmord und die Stimmung jener Tage, die ihm vorausgingen, durchdringt sich in diesem Film wie das Aufwachen mit den Momenten eines düsteren Traums. Manchmal ist es in "Last Days", als hörte man durch Cobain-Blake hindurch die Melodie einer ganzen Generation, so dicht ist dieser Film gewoben, so wenig Raum läßt er für die üblichen Kleinigkeiten des Kinos. Wie in "Elephant" wird hier die Zeit zum Raum, und wie sein Vorgänger ist auch "Last Days" ein sicherer Anwärter auf einen Preis in Cannes.
Der Kanadier Atom Egoyan hat an der Croisette vor acht Jahren mit "The Sweet Hereafter" den Großen Jurypreis gewonnen. Mit seinem neuen Film "Where the Truth Lies" setzt er fort, wofür er damals prämiert wurde. Egoyan ist ein Spezialist für Rekonstruktionen, für Geschichten, deren Ende vor dem Anfang des Films und deren Logik jenseits der bekannten Genremuster liegt. "Where the Truth Lies" erzählt einen Mordfall aus dem amerikanischen Entertainermilieu, aber für Egoyan ist die Suche nach dem Mörder eine Nebensache. Er entrückt die Haupthandlung in die frühen siebziger und ihre Vorgeschichte in die späten fünfziger Jahre, so daß die Erzählung zugleich zur doppelten Zeitstudie wird. Es ist, als sähe man "Chinatown" und "Vertigo" ineinander gespiegelt, so wie sich in der Heldin, der Reporterin Karen (Alison Lohman), die Femme Fatale des klassischen mit dem Flower Girl des neuen Hollywood mischt. Karen will ein Buch über den ehemals berühmten Stand-up-Komödianten Vince (Colin Firth) schreiben, der sich von seinem Partner Lanny (Kevin Bacon) getrennt hat, nachdem ein totes Mädchen im Hotelbadezimmer der beiden auftauchte. Sie recherchiert mit vollem Körpereinsatz - und erkennt in dem Opfer von damals zuletzt ihr eigenes Abbild.
Jeder Film von Egoyan ist zugleich eine intellektuelle Reise ins Innere des Kinos, in die Mechanismen der Täuschung, durch die es uns packt, und den Katalog der billigen Reize, mit denen es uns gefangen hält. Deshalb wirken seine Geschichten immer leicht steril, sie sind zu klug gebaut, als daß man sich ihnen rückhaltlos hingeben könnte. In "Where the Truth Lies" aber wird man für diesen Laborgeruch mehr als entschädigt durch die Cleverness, mit der Egoyans Darsteller agieren, die kristalline Architektur der Story und die Schönheit der Kulissen. Man kommt mit einem Hochgefühl aus diesem Film, das vielleicht ohnehin unvermeidlich ist, wenn man zwei Stunden lang neben Charlotte Rampling im Kino sitzen durfte.
ANDREAS KILB
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main








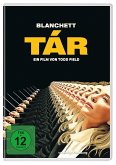
 FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG
FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG