
Clint Eastwoods Film "Flags of Our Fathers" zeigt ein berühmtes Kriegsfoto und das Geschäft, das mit ihm zu machen war
Der Fahnenmast war ein altes Wasserrohr, und die Soldaten, die auf dem Gipfel des Suribachi, hundertsechsundsechzig Meter über dem Meeresspiegel, am fünften Tag des Kampfs um Iwo Jima daran die amerikanische Flagge hochzogen, taten nur, was sie in solchen Fällen immer taten: eingenommenes Terrain markieren. Von diesem Akt gibt es kein Foto. Doch ein Minister wollte die Fahne vom Suribachi als Souvenir. Also wurde sie eingeholt, verpackt, verschickt. Und eine zweite wurde auf dem Berggipfel gehisst, von anderen Männern. Diesmal war der AP-Fotograf Joe Rosenthal dabei. "Wer will berühmt werden?", fragte er und drückte auf den Auslöser, als sechs GIs das Rohr in die Höhe stemmten. Sein Foto wurde eine der Ikonen der Kriegsfotografie, auf der Titelseite jeder amerikanischen Zeitung am nächsten Tag gedruckt, in Pappmaché in Stadien oder in Eis und Sahne bei Banketten nachgebildet und schließlich als Kriegerdenkmal in Washington in Bronze gegossen.
Diese beiden Fahnen sind die "Flags" im Titel von Clint Eastwoods Film "Flags of Our Fathers", der auf einem Bestseller gleichen Titels beruht, den James Bradley Jr., der Sohn eines der Fahnenhisser, vor einigen Jahren veröffentlicht hat. Seine Recherchen bilden die Rahmenhandlung (Drehbuch: Paul Haggis und William Broyles), die hauptsächlich dazu gut ist, uns daran zu erinnern, dass Eastwood von heute aus einen Blick auf die Ereignisse wirft. Und von heute aus sehen wir in den Vorgängen von damals vor allem zweierlei: dass Soldaten nicht fürs Vaterland sterben - und dass das Land, in dessen Namen sie töten und fallen, nur von einem tatsächlich etwas versteht, und das ist das Geschäft.
Die Schlacht um Iwo Jima, ein schwarzsandiges Vulkaninselchen im Pazifik, kostete annähernd dreißigtausend Soldaten das Leben. Siebentausend von ihnen waren Amerikaner. Sie landeten, vorbereitet und unterstützt von der U.S. Air Force, mit Hunderten von Schiffen am 19. Februar 1945. Die Japaner, zahlenmäßig um ein Vielfaches unterlegen, leisteten erbitterten Widerstand. Sie hatten, wohl wissend, dass sie kaum eine Chance hatten, mit dem Leben davonzukommen, ein weitverzweigtes Tunnelsystem in den Hügeln angelegt, um von dort aus so viele Amerikaner wie möglich zu erschießen, bevor sie selbst starben. Als die Amerikaner den Strand erreicht hatten, geschah erst einmal nichts. Erst als Tausende von ihnen an Land gegangen waren, fiel der erste gezielte Schuss. Die Japaner blieben in den Hügeln, zeigten sich nicht, sondern schossen aus ihren Verstecken heraus, was das Zeug hielt. Die GIs müssen geglaubt haben, von wütenden Geistern umgeben zu sein.
Entsprechend sehen wir in "Flags of Our Fathers" keinen einzigen lebenden Japaner, nur ein paar zerfetzte Leiber in Höhlen, in denen das Feuer verstummt ist. Wie die Japaner sich eingruben, wie sie kämpften und zum Teil von eigener Hand starben, zeigt Eastwood uns in seinem zweiten Film über diese entscheidende Pazifikschlacht, der "Letters of Iwo Jima" heißt, auf Japanisch gedreht wurde und gerade den Golden Globe für den besten fremdsprachigen Film gewonnen hat. Zwei Filme also über dasselbe Ereignis, einmal aus amerikanischer, einmal aus japanischer Perspektive, ein in der Filmgeschichte bisher einmaliges Unterfangen, in dem Sinn oder Unsinn des Krieges oder auch nur dieser Schlacht keinen Augenblick in Frage stehen. Dass die Filme nicht gleichzeitig ins Kino kommen, sondern um Wochen versetzt - "Flags of Our Fathers" startet am Donnerstag, "Letters from Iwo Jima" wird außer Konkurrenz bei den Berliner Filmfestspielen seine deutsche Premiere erleben -, ist eine ganz unverständliche Entscheidung, die vielleicht in der Annahme getroffen wurde, niemand wolle und könne zwei Kriegsfilme, in denen die Kamera nicht wegschaut, wenn es ans Sterben geht, in unmittelbarem Abstand hintereinander sehen.
"Flags of Our Fathers" ist in seiner Struktur komplizierter, er springt hin und her zwischen der Rahmenhandlung, dem Kriegsgeschehen und den Werbeauftritten der Fahnenhelden daheim in den Vereinigten Staaten. Dorthin nämlich wurden die drei von ihnen, die den Tag überlebten, unmittelbar nach Veröffentlichung des Fotos vom Suribachi ausgeflogen, um als frischgekürte Berühmtheiten die dringend benötigten Kriegsanleihen zu verkaufen, was ihnen in Milliardenhöhe auch gelang. Wie sie, die Helden, die sich selbst gar nicht heldenhaft vorkamen, sondern als Davongekommene, die eigentlich mit ihren Kameraden weiterhin an der Front hätten sein müssen, vom Kriegsministerium ausgenutzt, vermarktet, ausgestellt und schließlich alleingelassen werden, davon handelt Eastwoods Film ebenso wie vom Krieg als persönlichem Ereignis, in dem Politik nichts zählt.
Was zählt, ist der Einzelne in seiner kleinen Gruppe, der tötet, überlebt oder stirbt. Die Einzelnen, das sind der Sanitäter John Bradley (Ryan Phillippe), der als alter Mann (und Vater des Buchautors) in der Rahmenhandlung auftaucht, immer noch gejagt von seinen Erinnerungen an einen Freund, der auf Iwo Jima einfach verschwand; der Indianer Ira Hayes, der das Gefühlszentrum des Film ist, weil das Land, an das er glaubt, ihn so schmählich alleinlässt (mit so roher Emotion gespielt von Adam Beach, dass er den Film über alle Schwächen im Aufbau hinwegträgt); und der Kriegskurier Rene Gagnon (Jesse Bradford), der als Letzter begreift, dass im Frieden von Kriegshelden nichts bleibt als ihre Gestrigkeit.
Clint Eastwood hat inzwischen bei dreißig Filmen Regie geführt. Je älter er wird, desto klassischer wird sein Stil und desto dringlicher sein Interesse an der Gewalt, die den Geschichten, die ihn interessieren, innewohnt wie dem Land, von dem sie handeln. Es gibt kaum einen anderen Regisseur, der so wenig Lust an dieser Gewalt hat wie inzwischen Eastwood und der dennoch so genau hinschaut, wenn sie am größten ist, sei's im Ring, im Westen oder im Krieg. Die Unmittelbarkeit der Kampfszenen in den Iwo-Jima-Filmen, in denen die Kamera neben den Soldaten herrennt, mit ihnen stolpert, über sie hinwegjagt, wenn sie fallen, und links und rechts die abgeschlagenen Glieder streift, die von ihnen übrig bleiben, übertrifft noch die von Spielbergs "Saving Private Ryan", der für diese Art der Kriegsaufnahmen einen neuen Standard setzte und die beiden Eastwood-Filme mitproduziert hat. Doch anders als bei Spielberg gibt es hier nichts, was eine Erlösung andeutete. Sondern nur eine Endlosschleife der grausamen Erinnerung.
VERENA LUEKEN
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

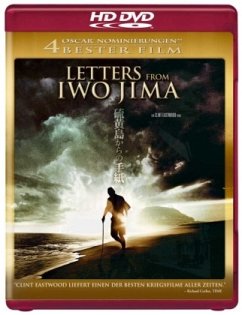
 FSK: Freigegeben ab 16 Jahren gemäß §14 JuSchG
FSK: Freigegeben ab 16 Jahren gemäß §14 JuSchG