Von seiner Kindheit im westfälischen Gronau bis zum ersten, alles entscheidenden Bühnenauftritt in Hamburg 1973; von seinen Anfängen als hochbegabter Jazz- Schlagzeuger und seinem abenteuerlichen Engagement in einer US-amerikanischen Militärbasis in der Libyschen Wüste, über Rückschläge mit seiner ersten LP bis zu seinem Durchbruch mit Songs wie "Mädchen aus Ost-Berlin" oder "Hoch im Norden" und "Andrea Doria": LINDENBERG! MACH DEIN DING erzählt die Geschichte eines Jungen aus der westfälischen Provinz, der eigentlich nie eine Chance hatte, und sie doch ergriffen hat, um Deutschlands bekanntester Rockstar zu werden - ein Idol in Ost und West.
Bonusmaterial
Audiokommentar mit Michael Lehmann (Produzent) und Hermine Huntgerburth (Regie) Premierenclip Musikvideo Interview mit Cast & Crew Featurtette
Wer den Mann mag, wird den Film mögen; wer nicht, der kann ihn nur als folkloristische Komödie ertragen. Nach Hermine Huntgeburths Biopic "Lindenberg! Mach dein Ding" stellt sich die Frage, ob das nicht ein Missverständnis ist: mit Udo, der deutschen Rocklegende.
Der Film heißt "Lindenberg! Mach dein Ding", und damit ist alles gesagt, aber es kommen dann noch 135 Minuten. In ihnen fallen Sätze wie: "Der Typ ist ein Obergorilla im Musikbusiness." Oder: "Ich hab die Schnauze voll von der Leisetreterei." Man begrüßt sich mit "Hey Meister" oder "Na, alter Leichtmatrose". Zum Abschied gibt es ein: "Macht's gut, Kinners". Wer aus dem Bett aufsteht, schafft seinen Arsch aus der Kiste, meist aber bleibt man länger in der Koje, denn die kleine Bordsteinschwalbe war mal wieder galaktisch, Indianerehrenwort.
Wer Udo Lindenberg mag, wird diesen Film mögen, klar: den Aufstieg des kleinen Udo aus Westfalen, der im Wohnzimmer für seinen alkoholsüchtigen Vater trommelte und später auf dem Hamburger Kiez auftrat, bis er zur Galionsfigur aller Kiezkapitäne und Paulas auf St. Pauli wurde und dann zur bundesrepublikanischen Kulturfigur. Eine deutsche Rocklegende. Das steht jetzt schon so lange überall, dass niemand mehr sagen muss, was das Legendäre ist, das die Legende zur Legende machte.
Wer Udo Lindenberg nicht so gern mag, wird ihn nach diesem Film noch immer nicht mögen. Der Regisseurin Hermine Huntgeburth ist mit ihrem Biopic ein "Best of Udo" gelungen, das eindrücklich zeigt, warum das Lindenberg-Genuschel auf der Anti-Udo-Seite kreative Gewaltphantasien erzeugt. Seine Kiezfolklore, Udos Moin-Sprache, das Pathos der Schlapphutinszenierung - vielleicht war all das irgendwann mal leicht und lässig und eine Befreiung vom Schlagerpomp; von heute aber betrachtet wirkt die Kunstfigur Udo Lindenberg so piefig wie das Wort piefig.
Das Schlimme am Film ist, dass er den jungen Lindenberg ohne jede gutmütige Ironie zeigt. Huntgeburth nimmt der Geschichte von Lindenbergs Durchbruch nichts von ihrer Schwere, im Gegenteil: Sie nutzt das Dramatisierungspotential voll aus. Beginnend mit der Eröffnungsszene, in der ein betrunkener Lindenberg, gespielt von Jan Bülow, die Stufen zur Bühne seines ersten großen Konzerts hinunterstolpert - und fällt. Der Held fällt. Was tut ein Held, der fällt, seit Odysseus oder spätestens Rocky? Richtig, er steht auf. Immer wieder, so wie er sein Leben lang jedes Mal wieder aufgestanden ist. In Rückblenden zeigt "Lindenberg! Mach dein Ding" dann dieses Leben, die Leiden des jungen Sängers, der alle Widerstände überwindet, um am Ende auf der Bühne zu stehen und die Logik der Erzählung zu erfüllen: Der Held wird aufstehen, vor jubelnder Menge.
Dazwischen passieren einige Dinge, die so peinlich sind, dass einen die Fremdscham tief in den Kinosessel drückt. Grundsätzlich haben alle Männer in "Lindenberg! Mach dein Ding" lange Haare, Koteletten und Schnauzer, aus denen man die "Astra"-Reste riecht. Oft tragen sie Haifischzahnketten. Alle Frauen sind hübsch. Nicht mehr. Ja, gut, späte sechziger, frühe siebziger Jahre auf dem Hamburger Kiez, da werden schon einige männliche Männer und schöne Frauen in Pelzmänteln herumgelaufen sein. Aber genauso wie Udo Lindenbergs Lieder dieses Klischee nie brechen, sondern immer bloß feiern, ist sein Biopic eine Folkloreveranstaltung. Mann, war die Zeit damals frei und wild, als die Luden noch Luden waren und den Freiern ihre Mädchen per Handschlag verkauften. Also für alle, die damals frei waren.
Jan Bülow spielt Udo Lindenberg genau so, wie man sich einen deutschen Künstler vorstellt. Leidend an der Welt, die das Genie nicht sieht, während der Künstler keinerlei Zweifel hat an seiner Genialität. Der junge Udo ist zwar schmächtig und schüchtern, aber er hat einen verträumten Charme, und deshalb oder weil gerade sexuelle Revolution ist oder weil er sie gern mal "meine Bordsteinschwalbe" nennt, bekommt der angehende Künstler jede Frau ins Bett. Wenn sie dann den Künstlercharakter nicht mehr aushält, ist das Künstlerherz gebrochen, und der leidende Künstler muss Künstlerdinge tun, wie ein einfühlsames Liebeslied schreiben. Das wird ihn endlich zu einem richtigen Künstler machen, gefeiert von aller Welt.
In jedem Moment, in dem der Bülow-Lindenberg einmal nichts sagen sollte, sagt er garantiert etwas, und das ist immer das Falsche. Wenn er am Sarg seines toten Vaters sitzt, darf der Sohn natürlich nicht einfach trauern. Er muss erklären, dass er trauert. Das Bild allein könnte schließlich niemand decodieren. Also monologisiert Bülow etwas von den Lindenbergs, die immer bloß Klempner waren, aber dass er, Sohn Udo, Rockstar werden wird. Vielleicht sagt er auch irgendwas über Vergebung, ganz sicher tut er das. Man kann bloß nicht mehr hinhören.
Dieses deutsche Fernsehfilmzuviel, das längst ein ähnlich nerviges Klischee ist wie die Klischees, die der typische deutsche Fernsehfilm aneinanderklebt (Kommissar mit Eheproblemen, Landärztin mit Patchworkfamilie, freundlich schwäbelnder Dönerverkäufer), dieses Übererklären, das einen Schauspieler, der einen nachdenklichen Menschen spielen soll, mindestens in die Pose von Rodins Denker zwingt, weil das Publikum sonst garantiert nicht verstünde, dass vor ihm auf dem Bildschirm jemand nachdenkt, dieses übertriebene Dramatisieren lässt einen "Lindenberg! Mach dein Ding" irgendwann bloß noch als Komödie sehen.
Eine der dramatischsten Szenen wird dann zu einer der unterhaltsamsten. Im nächtlichen Elbtunnel begegnet Lindenberg dem Kumpel, mit dem er seine Band gegründet hat (und auch mal einen LSD-Trip erlebt, inszeniert wie das Ergebnis einer Stockfotosuche nach "lsd trip": Farben, Lichter, Kreisel). Dieser Kumpel erklärt Lindenberg, dass er die Band verlassen wird, weil nichts vorangeht. Udo und er werden keine Stars werden und deshalb jetzt besser schnell mal erwachsen werden. Der Rockstartraum ist vorbei. Logisch kann er das aber nicht einfach so sagen. Der Kumpel sagt zu Udo: "Sieht irgendwie so aus, als hängst du im Trockendock fest. Ich geh von Bord." Und da bedauert man fast, dass der Kumpel nicht noch eine Kapitänsmütze lüpft oder zumindest ein "Ciao, Kakao" hinter sich in den hallenden Elbtunnel ruft.
Wer Udo Lindenberg nicht so gern mag, wird ihn nach diesem Film noch immer nicht mögen, aber zumindest erleichtert sein, wenn er am Ende auf der Leinwand auftaucht. Nach gut zwei Stunden grauenhafter Frisuren, fieser Hemdenmuster und ungezählter Moins in "Lindenberg! Mach dein Ding" ist man tatsächlich und überraschenderweise dankbar, als endlich der echte Udo Lindenberg auf einer Bühne sitzt und einen Song performt. Mit Brille und Hut und Zeilen wie: "Pack ich meinen Mut unter den Hut". Aber hey, nach dem Pathoskitsch dieses Films wirkt sogar ein Udo-Song das erste Mal angenehm neutralisierend, ungefähr so wie die Kaffeebohnen im Drogeriemarkt nach einem Sprühnebel "Tabac Gran Valor"-Parfüm.
FLORENTIN SCHUMACHER
Ab Donnerstag im Kino
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

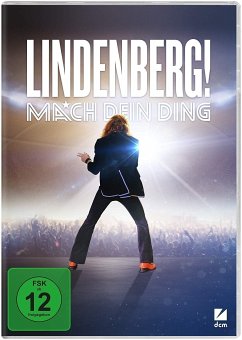










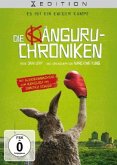


 FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG
FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG