Vier junge Frauen im Amerika Mitte des 19. Jahrhunderts, die ihr Leben selbstbestimmt nach eigenen Vorstellungen gestalten wollen und dabei teils große gesellschaftliche Hindernisse überwinden: LITTLE WOMEN folgt den unterschiedlichen Lebenswegen der March-Schwestern Jo (Saoirse Ronan), Meg (Emma Watson), Amy (Florence Pugh) und Beth (Eliza Scanlen) zu einer Zeit, in der die Möglichkeiten für Frauen begrenzt waren. Erzählt aus der Perspektive von Jo March, dem Alter Ego von Autorin Louisa May Alcott, und sowohl basierend auf dem Roman wie auch auf den persönlichen Schriften Alcotts.

Ein klassischer Roman über weibliche Schicksale als sein eigener Kontext: Greta Gerwigs Film "Little Women"
Da rennt Saoirse Ronan als Josephine "Jo" March durch das Menschengetriebe New Yorks und verkauft mit tintigen Fingern gegen Bares blutrünstige Kurzgeschichten an einen Zeitungsverleger, bevor sie wieder als Hauslehrerin in einem Gästehaus verschwindet und - ohne es zu merken - dem mittellosen Immigranten Professor Bhaer den Kopf verdreht. In einem Lusxusbiotop lebt dagegen die jüngere Schwester Amy (Florence Pugh): Als Gesellschafterin der stinkreichen Tante, in deren Rolle Meryl Streep desillusionierten Snobismus verbreitet, verfeinert sie auf Grand Tour durch Europa ihre Fähigkeiten als Malerin, schaut sich nebenbei (oder vor allem?) nach einer Partie zum Einheiraten in die bessere Gesellschaft um - und trifft den ebenfalls stinkreichen, aber gar nicht snobistischen Nachbarsjungen von zu Hause wieder: Laurie (Timothée Chalamet). Er hat dummerweise sein Herz an Jo verloren und leidet daran, dass sie ihn zurückgewiesen hat. Das kränkelnde Nesthäkchen Beth (Eliza Scanlen) indes zeigt derweil in Concord, was für eine Pianistin sie werden könnte, und die Älteste der Schwestern, die von Emma Watson als Schöne ohne Biest gespielte Meg, muss als junge Ehefrau und Mutter jeden Cent umdrehen, würde aber allzu gerne in einem neuen Kleid neben den wohlhabenden Freundinnen glänzen.
Ambitionen, Restriktionen, wahre Werte und falscher Schein in einer von Männern, den Gesetzen des Marktes und menschenverachtenden Ungleichheiten beherrschten Welt: Die Schwestern wurden geboren, als im Süden des Landes noch Sklaven gehalten wurden, der Vater zog in den Sezessionskrieg. Zurück in diese Zeit der Entscheidung, sieben Jahre vor dem, was wir zu Beginn sehen, springt die Geschichte, um dann in stetem chronologischen Hin und Her (das nebenbei perfekt zur fragmentierten Aufmerksamkeit von Smartphone-Nutzern passt), den Romanklassiker "Little Women" liebevoll, aber entschieden gegen den Strich zu bürsten, bis wir Heutigen sagen können: Ja, so hätten wir gerne, dass Louisa May Alcott ihre Geschichte für uns geschrieben hätte, so denken wir, dass sie sie selbst hätte schreiben wollen, wenn die Zeiten und die Möglichkeiten schon andere gewesen wären. Hätte sie?
Wer das Buch zur Hand nimmt, mag staunen, wie viel religiöse Erbauungsprosa es enthält, inspiriert von der allegorischen Seelenreise "The Pilgrim's Progress" des renitenten englischen Baptistenpredigers John Bunyan, und wie hoch im Kurs bei der von der transzendentalistischen Bewegung geprägten Schriftstellerin neben den neuenglischen Profanheiligen Emerson und Thoreau deutsche Philosophen wie Kant und Hegel oder die Weimarer Klassiker standen. Jos unwahrscheinlicher Verehrer, im Buch ein fast vierzigjähriger Gelehrter, ist tatsächlich Emissär eines Landes, wo nicht die Zitronen, aber der Geist der individuellen Freiheit, der Geist der Vernunft und der Romantik blühen. Als Sehnsuchtsland für Amerikaner in Europa hat Deutschland sich im zwanzigsten Jahrhundert selbst vernichtet; da ist es nur konsequent, dass Professor Bhaer heute von dem Franzosen Louis Garrel gespielt wird. Darüber, ob es gut war, ihn fast so jung und lebenslustig wie Laurie zu machen, lässt sich trefflich streiten.
Aber all das sind Nebensachen. Was Leserinnen schon immer mehr als Frömmigkeit oder Hochgeistiges für die "Little Women" eingenommen hat, ist die Lebensnähe, mit der Alcott schon in den frühen Zeiten der Frauen- und Bürgerrechtsbewegung Anliegen der Emanzipation darstellte. Darin besteht ihr bleibendes Erbe. Sie schrieb nicht im luftleeren Raum für ihre meist jugendlichen Leser, sondern schöpfte aus Erinnerungen an die eigene Kindheit. Jo, die zentrale Figur, das war eigentlich sie, die Burschikose, die schreibend und mit zahllosen Jobs eine vom idealistischen Vater nur mühsam finanziell versorgte Familie durchbrachte. Einzig dem Druck ihres Verlegers war es zu verdanken, dass die Hauptfigur im zweiten Band der Romanreihe schließlich Bhaer unterm Regenschirm küsst und die Ehe verspricht. Und das, obwohl die Heldin doch eigentlich lieber unabhängig geblieben wäre und ledig - wie Alcott selbst.
Greta Gerwig macht genau das zum Angelpunkt ihres Films. Keine der bisherigen Kinoadaptionen - ob 1933 mit Katharine Hepburn als Jo, 1949 mit Elizabeth Taylor als Amy oder 1994 mit Winona Ryder in der Hauptrolle - hat am Happy End gerüttelt. Gerwig dagegen veranstaltet ein hintersinniges Spektakel darum, dass die ganze Familie Jo zu ihrem Glück überreden will, die Wünsche des Publikums, der Literatur- und Filmindustrie persiflierend, und übergießt das Paar unter dem Regenschirm mit einem kalten metafiktionalen Schauer. Wir sehen eine konstruierte Geschichte - und den durch ein Zugeständnis an den Zeitgeist erkauften Triumph einer Schriftstellerin. Das mag ein Stich ins Herz aller Romantiker sein, macht aber den Kopf frei.
Voller Körpereinsatz wirft sich das Star-Ensemble ins Drama um den Tod der Kindheit und die Suche nach Wegen ins Leben als Frau. Gerwig fächert Möglichkeiten auf, diskreditiert Meg nicht als Hausmütterchen und lässt Amy Gerechtigkeit widerfahren, indem sie sie als rational, nicht nur selbstsüchtig zeichnet. Und Saoirse Ronan trifft mit schlafwandlerischer Sicherheit immer wieder die emotionalen Kipppunkte einer Figur, die sich mit "Lady Bird" sicher bestens verstünde.
Mit Gardinenpredigten hält Gerwig sich als Drehbuchautorin zurück. Dennoch: Diese Marchs sind fast unerträglich gut, eine makellose, liberale, wohltätige, im besten Sinne patriotische amerikanische Musterfamilie. Innige Wärme und Zuversicht wie die vorige, von Gillian Armstrong inszenierte Generation der "Little Women" in einer Zeit ausstrahlte, in der "Girl Power" feministischen Optimismus verbreitete und die Geschichte ansonsten angeblich zu Ende war, sind der neuen Version nicht zu eigen. Wenn Laura Dern als Marmee sagt, sie schäme sich manchmal für ihr Land, könnte sie auch Trump, Weinstein oder den Klimawandel meinen. Und wenn am Ende die Schule, die Jo gründet, als koedukativer Tummelplatz für Kinder aller Hautfarben gezeigt wird, geht das über die Visionen in Louisa May Alcotts Büchern hinaus. Warum auch nicht, hier zählt die Inspiration, nicht der historische Horizont. Mit ihrer klug distanzierten und fabelhaft inszenierten Aneignung, die auf sechs Oscars hoffen darf, erschließt Greta Gerwig "Little Women" einer neuen Generation. Doch wenn am Ende andeutungsweise die Schriftstellerin hinter ihrer Romanfigur Jo zum Vorschein kommt, drängt sich die Frage auf: Wäre ein Biopic über sie nicht noch interessanter gewesen?
URSULA SCHEER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
















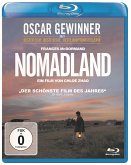
 FSK: Freigegeben ab 6 Jahren gemäß §14 JuSchG
FSK: Freigegeben ab 6 Jahren gemäß §14 JuSchG