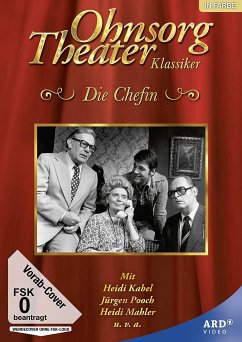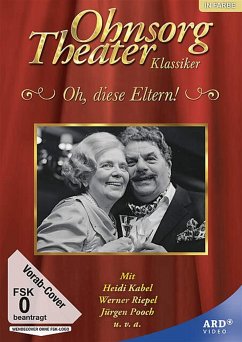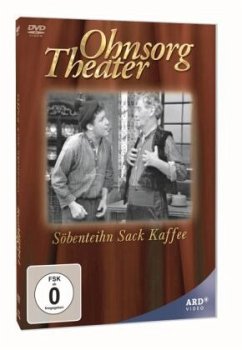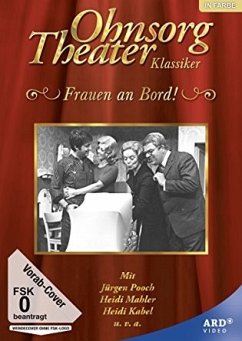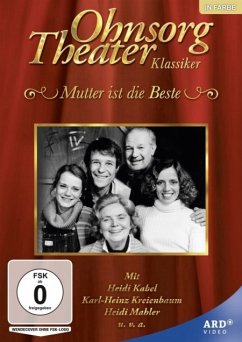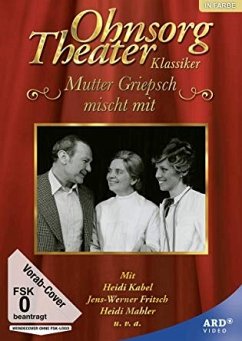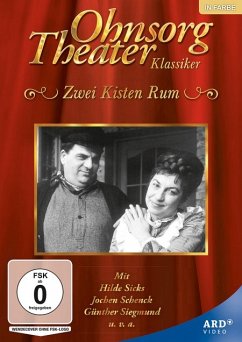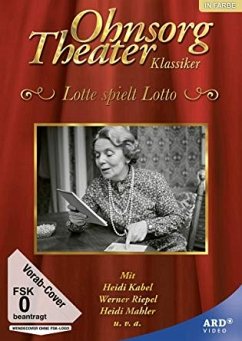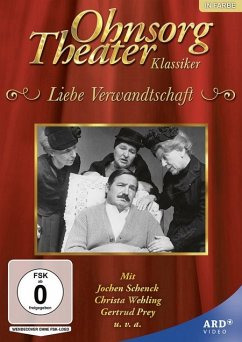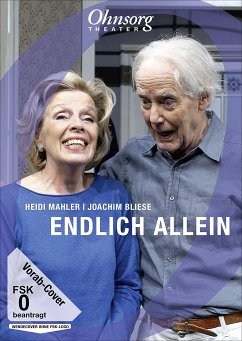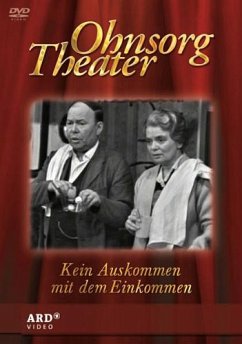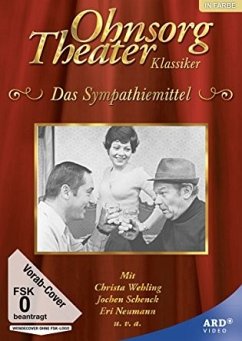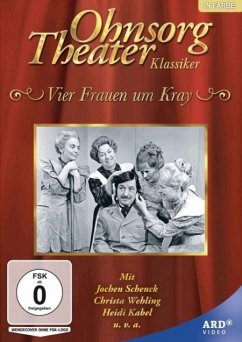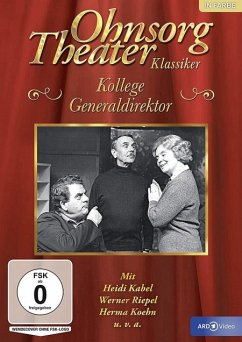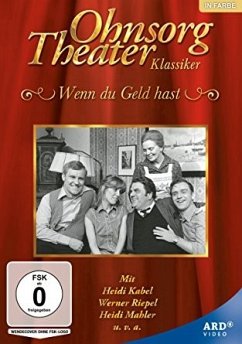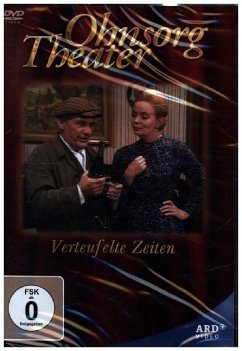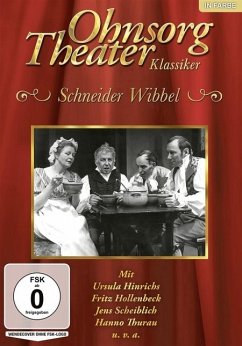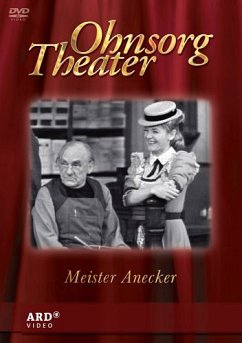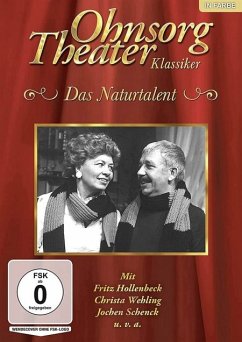Ohnsorg Theater - Die Königin von Honolulu
Die Königin von Honolulu
Nach e. Stück v. Gorch Fock; Mit Werner Riepel u. a.
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
11,49 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
6 °P sammeln!
Technische Angaben:
Bildformat: 4:3 Vollbild
Sprache / Tonformate: Deutsch (Dolby Digital Mono 2.0)
Ländercode: 2
Bildformat: 4:3 Vollbild
Sprache / Tonformate: Deutsch (Dolby Digital Mono 2.0)
Ländercode: 2
In der Seemannskneipe "Die Königin von Honolulu" in Hamburg St. Pauli sitzen um 1910 mürrisch die Matrosen und bedrängen ihren Heuerbaas, Krischon Honolulu, dass er ihnen endlich ein Schiff besorgen soll, denn in ihren Kassen ist Ebbe.
Da erscheint der Matrose Scharli und berichtet vom Einlaufen einer amerikanischen Luxusjacht, die dem Millionär William Thomson gehört, einem "Verrückten" und Weiberfeind, der mit seinem Geld nur so um sich wirft. Acht Seeleute werden für eine Weltreise gesucht, die auch nach Honolulu führen soll.
Kurze Zeit später trifft der Millionär selbst in der Schenke ein, um durch seinen Steuermann Hannes Meier die Lücken in seiner Mannschaft auffüllen zu lassen.
Durch geschicktes Verhandeln gelingt es dem Heuerbaas, seinen Schützlingen nicht nur eine gute Heuer, sondern sogar ein richtiges "Shanghaien" zu vermitteln, damit alle mal wieder einen "ordentlichen Duhntje" haben können. In Wirklichkeit beschließt Krischon, selbst noch einmal nach Honolulu zu reisen, und sogar das Waisenmädchen Lieschen wird, als Schiffsjunge verkleidet, mit an Bord gehen.
Da erscheint der Matrose Scharli und berichtet vom Einlaufen einer amerikanischen Luxusjacht, die dem Millionär William Thomson gehört, einem "Verrückten" und Weiberfeind, der mit seinem Geld nur so um sich wirft. Acht Seeleute werden für eine Weltreise gesucht, die auch nach Honolulu führen soll.
Kurze Zeit später trifft der Millionär selbst in der Schenke ein, um durch seinen Steuermann Hannes Meier die Lücken in seiner Mannschaft auffüllen zu lassen.
Durch geschicktes Verhandeln gelingt es dem Heuerbaas, seinen Schützlingen nicht nur eine gute Heuer, sondern sogar ein richtiges "Shanghaien" zu vermitteln, damit alle mal wieder einen "ordentlichen Duhntje" haben können. In Wirklichkeit beschließt Krischon, selbst noch einmal nach Honolulu zu reisen, und sogar das Waisenmädchen Lieschen wird, als Schiffsjunge verkleidet, mit an Bord gehen.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.