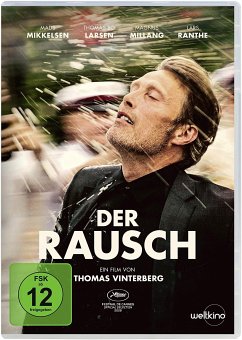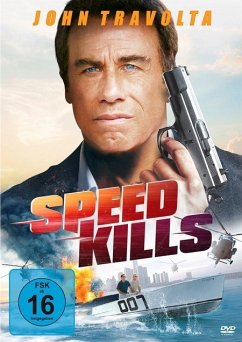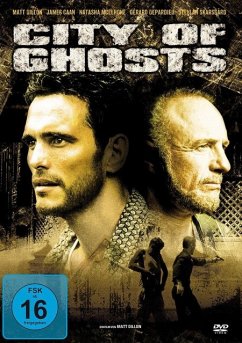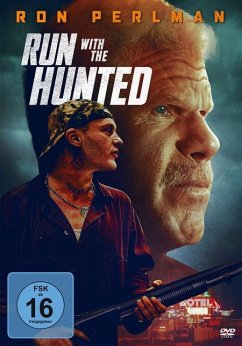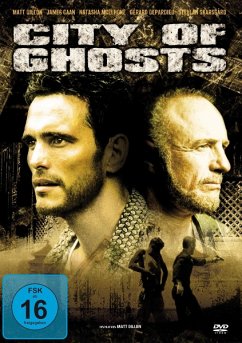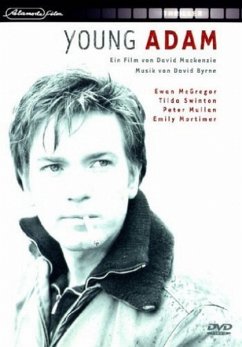Promising Young Woman

PAYBACK Punkte
5 °P sammeln!
Sie ist verführerisch, extrem gerissen und ihre Rache wird bittersüß! Von Cassie (Carey Mulligan) hieß es immer, sie sei eine vielversprechende junge Frau. Aber jetzt findet man sie immer öfter abends, vermeintlich betrunken, in einer Bar. Welcher Mann erwartet da noch etwas von ihr - außer leichte Beute zu sein? Ein fataler Irrtum ...