1862, Missouri zur Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges: Eigentlich haben die Freunde Jack Bull Chiles, Nachkomme eines reichen Plantagenbesitzers, und Jake Roedel, Sohn eines armen deutschstämmigen Handwerkers, nichts mit den Kriegswirren zu tun. Doch eines nachts wird Jacks Vater von Guerilla-Kämpfern, die mit den Unionstruppen sympathisieren, ermordet. Nach Rache dürstend schließen sich die Freunde daraufhin einer Gruppe Bushhawkers an, die auf Seiten der Südstaatler kämpfen, ohne direkt der Konföderierten-Armee anzugehören.
Unter Leitung des charismatischen Black John reiten und töten sie von nun an Seite an Seite mit den unterschiedlichsten Männern wie dem sadistischen Pitt Mackeson, dem aristokratischen Schöngeist George Clyde und dem von Clyde befreiten Sklaven Daniel Holt. Bei Wintereinbruch suchen Jack Bull, Jake, George Clyde und Daniel Holt Unterschlupf in einem Bretterverschlag im Wald, wo sie von den Bewohnern einer nahegelegenen Farm versorgt werden. Besonders die schöne junge Witwe Sue Lee hat es den Männern dabei angetan. Zwischen ihr und Jack Bull entwickelt sich eine leidenschaftliche Liebesbeziehung. Doch schon bald bricht der Schrecken des Krieges auch in diese Idylle ein und die Männer müssen zurück in die Schlacht. Nur zwei von ihnen werden zurückkehren...
Unter Leitung des charismatischen Black John reiten und töten sie von nun an Seite an Seite mit den unterschiedlichsten Männern wie dem sadistischen Pitt Mackeson, dem aristokratischen Schöngeist George Clyde und dem von Clyde befreiten Sklaven Daniel Holt. Bei Wintereinbruch suchen Jack Bull, Jake, George Clyde und Daniel Holt Unterschlupf in einem Bretterverschlag im Wald, wo sie von den Bewohnern einer nahegelegenen Farm versorgt werden. Besonders die schöne junge Witwe Sue Lee hat es den Männern dabei angetan. Zwischen ihr und Jack Bull entwickelt sich eine leidenschaftliche Liebesbeziehung. Doch schon bald bricht der Schrecken des Krieges auch in diese Idylle ein und die Männer müssen zurück in die Schlacht. Nur zwei von ihnen werden zurückkehren...
Bonusmaterial
- Interviews mit Cast & Crew - Featurette - B-Roll - Kinotrailer
"Ride with the Devil" und "Tiger & Dragon": Zwei Filme des amerikanischen Regisseurs Ang Lee gleichzeitig im Kino
Wenn es im Kino je einen zweisprachigen Regisseur gab, dann ist es Ang Lee. Lee, 1954 in Pingtun auf Taiwan geboren, kam mit vierundzwanzig Jahren nach New York. Dort erlernte er die Sprache des Films. Seither benutzt er diese Sprache, um sich seiner asiatischen Wurzeln zu versichern - und um die Welt, der er entstammt, in Europa und Amerika wiederzuentdecken. Er entdeckte sie in den Gefühlskonflikten des britischen Landadels bei Jane Austen ("Sinn und Sinnlichkeit", 1995), im Erfahrungshunger des amerikanischen Kleinbürgertums der Nixon-Ära ("Der Eissturm", 1997) und unter den Freischärlern des amerikanischen Bürgerkriegs ("Ride with the Devil", 1999).
Zugleich hat Lee mit "Eat Drink Man Woman" (1994) und zuletzt mit "Tiger & Dragon" zwei geradezu mustergültig asiatische Filme gedreht, Filme, die sich eingemeinden wollen in eine Tradition jenseits von Hollywood. Daß er gerade mit "Tiger & Dragon" nun endgültig den Sprung unter die wichtigsten amerikanischen Filmregisseure geschafft hat, gehört zur Ironie von Ang Lees Karriere. Lees Kino ist die Zweideutigkeit als System, und da diese Zweideutigkeit die Sprache des Films spricht, drückt sie sich in Bildern aus, die oft hintergründiger sind als die Wortspiele eines Zen-Meisters.
In "Ride with the Devil", Lees vorletztem Film, der seit Donnerstag in den deutschen Kinos läuft, sieht man einen jungen Schwarzen und einen jungen Weißen auf einem Hügel westlich des Missouri sitzen und in die Landschaft schauen. Beide tragen Bart und Hut, denn es ist Krieg, und es ist Winter. Der Schwarze, ein freigekaufter Sklave, kämpft auf der Seite der Konföderierten für die Beibehaltung der Sklaverei. Der Weiße, Sohn eines deutschen Farmers, der mit den Nordstaaten sympathisiert, hat sich mit seinem Jugendfreund den bushwackers angeschlossen, Freischärlern, die einen blutigen Kleinkrieg gegen die Truppen des Nordens führen. Die bushwackers haben einen feindlichen Postsack erbeutet, und nun liest der Weiße dem Schwarzen, der nicht lesen kann, aus den darin gefundenen Briefen vor.
"Liebe Söhne . . . Liebe Mutter . . . Mein lieber Mann": Es sind Nachrichten von zu Hause, Mitteilungen über das Wetter und die Nachbarn, die Verwandten und die zu erwartende Ernte, und während Jake (Tobey Maguire) sie vorliest, sieht man, wie die beiden Männer von einem Leben zu träumen beginnen, das sie niemals hatten und vielleicht auch nie haben werden, einem Leben jenseits des Krieges. Man staunt über dieses Bild, und zugleich sieht man, wie die Kamera, die es aufnimmt, darüber staunt. Nicht, daß die Sehnsucht nach einem Zuhause und einer Familie irgendwie ungewöhnlich wäre, im Gegenteil: Sie ist die menschliche Sehnsucht schlechthin. Aber Ang Lee gelingt es, das Selbstverständliche so zu inszenieren und anzuschauen, als sähe er es zum ersten Mal. Der amerikanische Bürgerkrieg, im Kino gewöhnlich ein Gewoge feldgrauer und -blauer Massen, die einander an die Schnauzbärte gehen, wird bei Lee zu einer Erfahrung geteilter Einsamkeit. Am Ende des Films heiratet Jake die Frau, mit der sein Jugendfreund vor seinem Tod ein Kind gezeugt hat, und zieht mit ihr nach Kalifornien, ins Land der Überlebenden.
"Ride with the Devil" war in Amerika ein kommerzieller Mißerfolg, und wenn man sieht, wie Lee das historisch belegte Massaker an den Einwohnern der Stadt Lawrence, Kansas, inszeniert hat, versteht man, warum. Da werden Amerikaner von Amerikanern mit Kopfschüssen liquidiert, in den Straßen türmen sich die Leichen, und die Skalpjäger verrichten ihr widerliches Geschäft. Die Bürger jener Nation, die mal in Saddam Hussein, mal in den Russen oder dem Vietcong die Verkörperung des Bösen ausgemacht hat, werden ungern im Kino darüber aufgeklärt, daß sie selbst einmal Barbaren gewesen waren. Wie einst Ciminos "Heaven's Gate" verstößt "Ride with the Devil" gegen die Tabus des amerikanischen Mythos - und wie Ciminos Film hat auch der von Lee eine komplizierte Wahrhaftigkeit, die ihn aus den üblichen Geschichtserzählungen Hollywoods heraushebt. Man erfährt viel über Amerika bei Ang Lee, dem Taiwanesen aus New York.
Die Zuneigung, die das amerikanische Publikum Lees Bürgerkriegsepos verweigert hat, schlägt nun seinem jüngsten Werk "Tiger & Dragon" entgegen, einem Film, der mit Amerika nicht das geringste, mit Ang Lees Herkunft dagegen sehr viel zu tun hat. Wie jedes Schulkind zwischen Ulan Bator und Hanoi ist Lee mit der Sagenwelt der wuxia, der legendären Schwertkämpfer, aufgewachsen, einer Gattung, die im chinesischen Sprachraum eine ähnlich gewaltige Popularität besitzt wie hierzulande einst die Romane von Karl May; und wie jeder asiatische Kinogänger hat auch Ang Lee lange vor Quentin Tarantino und den Wachowski-Brüdern die in Hongkong produzierten Filmversionen der wuxia-Romane gesehen, Filme wie "Ein Hauch von Zen" (1969), "Peking Opera Blues" (1986), "Meister des Schwertes" (1990) und viele andere. Wer mit den Werken des großen King Hu und des nicht minder verehrungswürdigen Ching Siu-Tung vertraut ist, wird in Lees "Tiger & Dragon" wenig Neues finden. Für alle anderen aber, also für die große Mehrheit der westlichen Zuschauer, ist dieser Film eine visuelle Offenbarung.
Helden, die übermenschliche Kraft und Geschicklichkeit besitzen, sind auch aus dem abendländischen Actionkino bekannt. Die chinesische Mythologie verknüpft die Vorstellung körperlicher Überlegenheit jedoch außerdem noch mit der Aufhebung der Schwerkraft. So sieht man in "Tiger & Dragon" Frauen und Männer, die Engeln gleich über Dächer und Mauern schweben, auf Baumspitzen balancieren und wie vom Wind aufgewirbelte Blätter durch die Luft sausen; man sieht Schwärme von Giftpfeilen, die am blinkenden Stahl eines mit irrwitziger Geschwindigkeit rotierenden Schwertes abprallen, Klingen, die sich durch meterdicken Stein bohren, und menschliche Fäuste, die schneller zuschlagen, als man schauen kann. Die Schauplätze, an denen solche Wunder geschehen, sind aus zahllosen martial-arts-Filmen bekannt: der Palast; das abgelegene Kloster; die Taverne; die finstere Höhle; die nächtliche Stadt. Und wie die Schauergeschichten des Okzidents hat auch dieser Zauber seine stärksten Momente in der Dunkelheit, wenn man nur ahnt, was geschieht. Der Stolz der neuen digitalen Demiurgen Hollywoods, die ihre Künste aufdringlich vorzeigen, statt sie zu verwischen, hat in Lees Film nichts zu suchen. Hier gilt noch das altmodische Gesetz der Suggestion.
"Tiger & Dragon" hat, leider, auch eine Geschichte. Sie handelt von einem Mann und drei Frauen. Li Mu Bai (Chow Yun Fat), ein fahrender Krieger, der vom Kämpfen genug hat, übergibt sein Schwert, das "Grüne Schicksal", an seine langjährige Gefährtin Yu Shu Lien (Michelle Yeoh). Yu Shu verliert die Zauberklinge an die halbwüchsige Jen Yu (Zhang Ziyi), hinter der die alte Hexe Jade Fuchs (Cheng Pei Pei) ihre Fäden zieht. Gut und Böse streiten um die Seele des Mädchens, das sich außerdem einem Banditenfürsten aus der Wüste Taklamakan versprochen hat. Zuletzt müssen die alten Kämpen sterben, damit das junge Paar seinen Frieden hat, doch dieses Happy-End ist Lee zu rosig; deshalb wirft er seine Heldin aus dem Wolkenkuckucksheim, das er für sie erbaut hat.
An alledem gäbe es nichts zu mäkeln, wenn Ang Lee und sein Drehbuchautor James Schamus sich mit der märchenhaften Schlichtheit ihres Sujets (das aus einem vor hundert Jahren entstandenen Roman von Wang Du Lu stammt) abgefunden hätten. Aber Lee und Schamus wollten unbedingt einen ganz besonderen Schwertkämpferfilm drehen - einen feministischen womöglich und einen politisch korrekten obendrein. Deshalb wirkt "Tiger & Dragon" über weite Strecken wie eine Sage, die von einem Sagenforscher geschrieben wurde. Chow Yun Fat, der Superstar des asiatischen Kinos, steht oft steif wie eine Ritterpuppe in der Landschaft, und die neunzehnjährige Zhang Ziyi ringt sichtlich überfordert mit der Aufgabe, die vielen Facetten ihrer Figur darzustellen. Schwertkämpferfilme müssen nicht schlau, sie müssen überwältigend sein. Ein martial arts movie, das, wie dieses hier, allzu intensiv über sich selbst nachdenkt, wirkt nicht clever, sondern verspannt.
Am Ende ist die amerikanische Begeisterung für Lees Film, der, wie berichtet (F.A.Z. vom 22. 12. 2000), als Favorit für die diesjährige Oscar-Verleihung gilt, interessanter als der Film selbst. Hollywood, heißt es, habe ein schlechtes Jahr gehabt; aber so schlecht kann kein Hollywoodjahr sein, daß ein auf Mandarin gedrehtes Märchen aus der Qing-Dynastie zum Anwärter auf den Preis des besten Films werden müßte. Es ist die Sehnsucht nach heilen Mythen, die "Tiger & Dragon" unter die Oscar-Kandidaten hebt. Bis vor dreißig Jahren kamen diese Mythen aus den Tälern und Steppen des alten Westens. Dieser Brunnen ist versiegt. Nun sprudeln die Quellen Asiens. Sie liefern den Stoff, der die Räder der Traumfabrik treibt.
ANDREAS KILB
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

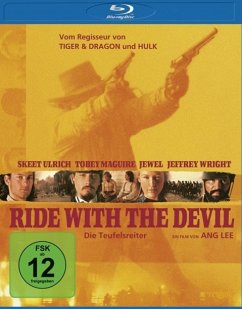
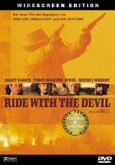






 FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG
FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG