
So viel Papier für ein Stück Zelluloid: Zu neuen Filmen nach Romanen von Frank McCourt, John Irving und David Guterson
Kinomoden sind flüchtig, Filmgenres vergänglich, und so wird auch die Welle von Highschool-Dramen, mit denen die Hollywood-Studios gegenwärtig den Markt überschwemmen, irgendwann wieder verebben. Nur Literaturverfilmungen gedeihen allezeit wie das Gras. Noch immer, scheint es, kann das Kino auf die großen Romane nicht verzichten, aller digitalen Zauberei zum Trotz. Und nach wie vor gilt, dass ein Buch so lange unverfilmbar ist, bis es verfilmt wird. Schon duckt man sich in Deutschland vor dem Fernsehmehrteiler, den Margarethe von Trotta derzeit aus Uwe Johnsons "Jahrestagen" macht. Im kalifornischen Westen wird unterdessen Cormac McCarthys "All die schönen Pferde" für die Leinwand zubereitet. Nur das Komplizierte und Gebrochene entgeht dem Zugriff der Maschinerie. Die Bilderfabrik mag keine Experimente: Thomas Harris ist ein Riese, Thomas Pynchon ein Zwerg in dieser verkehrten Welt.
Früher glaubten die Mächtigen der Filmindustrie, Literatur nach Hollywood holen zu können, indem sie Literaten im Dutzend in den Schreibbaracken der Studios einquartierten. Nicht nur Faulkner und Fitzgerald, auch Somerset Maugham und Evelyn Waugh wurden als Drehbuchautoren angestellt, von kleineren Talenten zu schweigen. Kommerziell gelohnt hat sich diese Kunstförderung nie. Als das Studiosystem zerbrach, wurde der Bestseller, der massenhafte Verkaufserfolg, zum Maß aller verfilmbaren Dinge. Arthur Hillers "Love Story" nach Erich Segals Roman schuf das Muster für eine direktere Vernetzung von Buchstaben und Bildern.
Fortan wurden Filmrechte an populären Büchern wie Schürfkonzessionen für Diamantminen gehandelt. Von berechnend bibliophilen Produzenten angeleitet, übte das Kino wieder Respekt vor dem geschriebenen Wort. Bernd Eichinger etwa hat eine besondere Kunst daraus gemacht, Erfolgsromane von hilfswilligen Regisseuren so einrichten zu lassen, dass die Adaption durch und durch nach Buch schmeckt und doch die Mühsal des Lesens erspart: Jeder Film ein Bonsai seiner Vorlage.
Nicht immer erscheinen Verfilmungen von Beststellern so pünktlich, wie es dem Buchhandel gefällt. John Irvings "Gottes Werk und Teufels Beitrag" hat fast fünfzehn Jahre von der Romanveröffentlichung zur Kinoversion gebraucht, David Gutersons "Schnee, der auf Zedern fällt" vier Jahre, Frank McCourts "Asche meiner Mutter" immerhin noch drei. So lange können reiselustige Leser nicht warten. Als Alan Parker nach Limerick fuhr, um McCourts irische Kindheitserinnerungen zu verfilmen, trug er ein Bündel Straßenkarten unter dem Arm, die er von einer japanischen Fan-Website heruntergeladen hatte. In dem Städtchen selbst wurden bereits Fußgängertouren zu den Schauplätzen des Romans angeboten. Parkers Film konnte freilich wenig von dieser touristischen Erschließung profitieren, denn der Wirtschaftsboom in Irland hatte mit dem von McCourt beschriebenen Elend gründlich aufgeräumt. Die grauen Mauern der Roden Lane, in der die Familie des Erzählers gehaust hatte, mussten auf einem Industriegelände in Dublin nachgebaut werden. Achtzig Zimmerleute, Stuckateure und Kulissenmaler schufteten drei Monate lang, um die Slums des alten Limerick wieder zu beleben.
Der Film beeilt sich, diese Anstrengung zu würdigen. Selten wurde ein Buch derart denkmalpflegerisch in Bilder gegossen. Von der Ankunft der Familie McCourt im Irland der Vorkriegszeit, in das Malachy (Robert Carlyle) und Angela (Emily Watson) mit ihren Kindern wider besseren Rat aus Amerika zurückkehren, bis zum neuerlichen Auszug des halbwüchsigen Sohnes Frank (Michael Legge) in die Welt jenseits des Ozeans ist jede Szene unter Parkers Regie in Ehrfurcht erstarrt. "Die Asche meiner Mutter" lasse den Humor der Vorlage vermissen, bemängelten die amerikanischen Kritiker des Films, aber wer so genau nachbaut, nachstellt, nachbetet wie Parker, hat für Witzigkeit keine Zeit. Stattdessen muss man die Arbeit der Regenmaschinen bewundern, die ihr Nass aus dem grauen Himmel über Kino-Limerick auf die Darsteller regnen lassen jeglichen Tag.
Ein Aufsatz über "Jesus und das Wetter" hat dem jungen McCourt einst das Wohlwollen seiner Lehrer eingetragen; dem Film erhält das schlechte Wetter, das in ihm herrscht, die Gunst seines Publikums. Denn so roh kann kein Zuschauerherz sein, dass es von den sieben Akten Regen, die McCourt auf die Leinwand bringt, nicht doch gerührt wäre. Wer dieses Klima überlebt, Kohlen schaufelt, Telegramme ausfährt oder gar einen Film zu Ende dreht, verdient unsere Sympathie. Für den Kalifornier oder Süditaliener, der vom Regen immer nur liest und sich wundert, warum die McCourts das überschwemmte Parterre ihrer Wohnung in der Roden Lane "Irland" und den trockenen ersten Stock "Italien" nennen, hat Parkers Interpretation den Vorzug sinnlicher Evidenz. Wenigstens meteorologisch ist "Die Asche meiner Mutter" eine angemessene Umsetzung von McCourts Buch, das nun für immer in die Regenschleier Alan Parkers getaucht sein wird.
John Irvings Roman "Gottes Werk und Teufels Beitrag", 1985 erschienen, spielt etwa zur gleichen Zeit wie McCourts Erinnerungen im amerikanischen Ostküstenstaat Maine. Hier fällt eher Schnee als Regen, das Leben wiegt sich im Rhythmus der Big Bands aus dem Autoradio, und im Waisenhaus von St. Cloud's hoch über dem Flusstal haben Dr. Wilbur Larch und sein Schützling Homer Wells viel Zeit, über Geburt, Abtreibung, Empfängnis und den Sinn des Lebens zu reden, während die Waisen im Schlafsaal zu kräftigen amerikanischen Mädchen und Jungen heranreifen. Eines Tages zieht Homer hinaus ins Leben und arbeitet als Pflücker auf einer Apfelfarm, bis die Schwiegertochter des Hauses ein Kind von ihm bekommt. Schließlich kehrt er, mild und weise geworden, nach St. Cloud's zurück und übernimmt den Posten seines verstorbenen Wohltäters. Muss man das sehen? Man muss: Lasse Hallström, ein Schwede in Hollywood, hat Homers Geschichte verfilmt.
"Gottes Werk und Teufels Beitrag" hat in der deutschen Übersetzung 760 Seiten; Hallströms Werk, das von nächster Woche an in den deutschen Kinos läuft, dauert gut zwei Stunden. Das ergibt etwa zehn Sekunden Film pro Buchseite. Entsprechend ist die Erzählung geschrumpft. Dadurch tritt, wie in früheren Irving-Verfilmungen von George Roy Hill ("Garp und wie er die Welt sah") und Tony Richardson ("Hotel New Hampshire"), der Hang zum Idyll, der in den Büchern dieses Autors von einem dicken Firnis oberflächlicher Konflikte verdeckt wird, offen zutage. Aber selbst den Rest an dramatischer Bewegung, der in hundertzwanzig Kinominuten möglich gewesen wäre, hat Irving, der selbst das Drehbuch schrieb, glatt gebügelt. Der Regisseur Hallström konzentriert sich seinerseits darauf, die Hauptdarsteller - allen voran Charlize Theron als Kriegsbraut Candy Kendall - in möglichst jeder Lebenslage gut aussehen zu lassen. So kommt es, dass das Leben von Homer (Tobey Maguire), Wilbur (Michael Caine) und all den anderen wie eine Folge von Ansichtskarten aus den vierziger Jahren wirkt. Wo Parkers McCourt-Adaption wenigstens eine Ahnung menschlicher Nöte bewahrt, ertrinkt Hallströms Film in weltlosem Kitsch.
David Guterson hat am Drehbuch zu der Verfilmung seines Romans "Schnee, der auf Zedern fällt" nicht mitgearbeitet. Guterson tat etwas viel Klügeres: Er koproduzierte den Film. Mehr Kontrolle kann sich ein Autor nicht wünschen. Gutersons Roman, der besonders in Deutschland viele Käufer fand, spielt auf einer Insel vor der Pazifikküste bei Seattle, in einer Zeit, auf die noch der Schatten des Zweiten Weltkriegs fällt. Ein Fischer, Sohn japanischer Immigranten, ist angeklagt, seinen deutschstämmigen Kollegen wegen eines Streits um Land ermordet zu haben. Der Journalist Ishmael Chambers, der über den Prozess berichtet, erinnert sich zwischen den Sitzungen an seine unglückliche Liebe zu Hatsue, der Frau des Angeklagten. Es geht um den alltäglichen Rassismus Amerikas, den Hass zwischen Weißen und Asiaten, der zuletzt im Triumph der Menschenliebe erlischt. Ein Film, der sich auf die komplizierte Rückblendenstruktur einlässt, mit der das Buch seine vergleichsweise schlichte Botschaft umkleidet, läuft Gefahr, sich darin zu verlieren - in den Rückblenden wie in der Botschaft. Beides ist Scott Hicks, dem Regisseur von "Schnee, der auf Zedern fällt" (Kinostart: 23. März), passiert.
Hicks, betreut von Guterson, wollte das Buch vollständig in die Verfilmung hinüberretten. Deshalb reduzierte er jede Episode auf ihren Handlungskern: hier ein Liebespaar im Wald, dort eine Zeugenaussage vor Gericht. Aber Bücher handeln, wie Filme, nicht bloß von dem, was in ihnen geschieht. An den Bruchstellen zwischen Ereignissen, dort, wo bei Guterson der Atem des Erzählers einsetzt, klingelt bei Hicks nur der Wecker für den nächsten Auftritt. Mal fährt der Film mit Hatsue in eines jener Internierungslager für japanischstämmige Amerikaner, welche die amerikanische Regierung während des Krieges betrieb, mal landet er mit dem Soldaten Chambers am Strand von Tarawa, aber nie lässt er dem Zuschauer Zeit zu spüren, was es bedeutet, dort zu sein, wo seine Helden gerade sind.
So steht die Regie am Ende mit leeren Händen da. Der alte Max von Sydow, der den Verteidiger des Japaners Kazuo spielt, muss in wohl klingenden Worten erklären, wofür Hicks keine triftigen Bilder findet: dass hier nicht nur ein Mensch, sondern die Menschheit selbst vor dem Richter stehe. Von Sydow entledigt sich seiner Aufgabe mit einer Lässigkeit, die an Ironie grenzt. In einer Literaturverfilmung, wie man sie sich für Gutersons Roman gewünscht hätte, wäre diese Szene ein Schmuckstück. Doch solche Filme sind so selten wie der Schnee, der auf Zedern fällt.
ANDREAS KILB
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

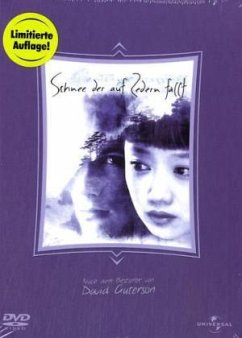


 FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG
FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG