"Schultze gets the blues" handelt von Schultze. Schultze fristet sein Leben seit Jahr und Tag in einem kleinen anhaltinischen Ort nahe der Saale. Schultzes Leben zwischen Arbeit und Kneipenbesuch, Schrebergarten, Volksmusik sowie Angeln kommt zu einem vorzeitigen Ende, als er und seine Kumpels Manfred und Jürgen in den Vorruhestand geschickt werden. Während diese sich mehr und mehr dem Nichts ergeben und das Aufrechterhalten der Routine zu einer Farce verkommt, entdeckt Schultze ein Leben hinter dem Berg.
Bonusmaterial
DVD-Ausstattung / Bonusmaterial: - Kinotrailer - Kapitel- / Szenenanwahl - Audiokommentar von Produzent Michael Schorr - Teaser-Trailer - Promo-Trailer
Der Botschafter des deutschen Films am Lido heißt Schultze
VENEDIG, 3. September.
Nicole Kidman, deren abgehagertes Gesicht von einem offiziösen Programmplakat herablächelt, hat dem Filmfestival in letzter Sekunde die kalte Schulter gezeigt. Das wäre sehr leicht zu verschmerzen, wäre wenigstens Horst Krause gekommen. Die Breitwandpräsenz dieses Schauspielers begeisterte das Publikum im einzigen Gegenwartsbeitrag, den das kümmernde deutsche Kino hier abzuliefern imstande war: "Schultze gets the blues" von Michael Schorr. Das Sittenbild aus der sachsen-anhaltinischen Provinz, wo der frühpensionierte Salzbergmann Schultze an der Ziehharmonika seiner traditionellen Polka abschwört und den flotten Zydeco aus Louisiana entdeckt, lebt von einem lakonischen Humor - etwas Buck, etwas Kaurismäki - und von der lebensechten Szenerie der gewesenen DDR. Vor allem aber lebt "Schultze" von Krause, den man sich gern am Lido beim Strandspaziergang in Badehose vorgestellt hätte, beim cineastischen Plaudern mit Omar Sharif und Gina Lollobrigida. Doch Krause blieb zu Hause.
Die Ursache der offenkundigen internationalen Zuneigung für das Mitteldeutschland, das Schorr schildert, liegt auf der Hand. Es ist ein Deutschland der Bierbäuche, der Gartenzwerge, der Karnevals- und Blasmusikvereine, der kaputten Schwerindustrie. Es ist dieses Land, das den Berlusconis und Stefanis, aber auch allen kultivierteren Franzosen, Polen und Amerikanern vorschwebt, denken sie an Deutschland. Es ist von ungeschlachten Menschen namens Schultze, Schulz, Strunz oder Krause bevölkert, die dann aber neben ihrem häßlichen Deutschsein plötzlich überraschende Gemütstiefe offenbaren. Wenn Krause alias Schultze auf seinem Schifferklavier mit Innenschau Melodiebögen sucht, wenn er mit Buddhablick bei seiner dementen Mutti im Altenheim ausharrt, wenn er behaglich das Bierchen in seiner Datsche unter der Abraumhalde kippt, wenn er als Verkäufer einer Türenfirma vor einem Abholmarkt wegschnarcht - wenn er sich also pflichtgemäß als einsamer, frühpensionierter, aber vor allem tiefromantischer Deutscher outet, wird er in diesem komischen und zärtlichen Film zur Ikone des international nicht vorhandenen germanischen Kinos.
Schorrs feiner Spielfilmerstling lebt außer vom DDR-Design, das in monumentalen, endlosen Halbtotalen gewürdigt wird, von Dutzenden feinen Slapstick-Einfällen: Schultze verrußt mit einem alten Brennofen einen Gebrauchtwagenmarkt, Schultze sprengt mit nervösem Swing die Jubiläumsfeier seines Musikvereins, Schultze schippert schließlich einsam durch die Sümpfe von Louisina auf der urdeutschen Suche nach seiner halbverklungenen Lebensmelodie. Die obligatorische Amerikareise à la Sägebrecht fügt dem Werk aber nichts Entscheidendes hinzu. Statt weiter alle Klischees zu überdrehen und in den köstlichen Saale-Unstrut-Humor hineinzuhorchen, muß dieser Film am Ende noch zum zähen boat movie werden. Doch hat der Pfälzer Schorr bewiesen, daß die DDR dem vereinigten Vaterland wenn schon keine Goldmedaillen bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft, so doch großartige Filmkulissen beschert hat.
Auch Paris ist eine nette Filmkulisse, zumindest für einen kalifornischen, von Europa begeisterten Regisseur wie James Ivory. Er sucht die Tristesse am anderen Ende der Schultze-Skala, nämlich beim französischen Landadel. In dieses heikle Soziotop hat die naive Amerikanerin Roxy hineingeheiratet, und als sie dann ihr gefühlskalter Gatte mit Kind und Schwangerschaft zurückläßt, soll die angereiste Schwester Kelly (als echtes US-Cremeschnittchen großartig: Kate Hudson) helfen. Weil die sich aber in den attraktiven Onkel Edgar (als aristokratischer Herrenmensch perfekt: Jean-Jacques Pivert) verliebt und sich ihm zuliebe in alteuropäische Seidenwäsche zwängt und grellrote Hermès-Krokotäschchen spazierenträgt, wird "Le divorce" zum transatlantischen Familienkrieg um Habe und Gefühle, Stil und Ehre.
Leichen und Brokat.
Ivory hat einen verrückten und doch einleuchtenden Film gedreht, der paradigmatisch das französisch-amerikanische Verhältnis beleuchtet: zwei voneinander faszinierte, einander abgrundtief verachtende Kulturen, die einander niemals verstehen werden. In der gelassen und plaudernd inszenierten Komödienhandlung, die am Ende auch noch - quel horreur americain! - mit Leichen gespickt wird, sind die Restaurantszenen die allergelungensten. Wie sich die knuffige US-Family mit den raffinierten Gerichten herumschlägt und sich streitet, ob in den neunhundert Euro auch das Trinkgeld enthalten ist. Wie das US-Girl voller Wollust ihren gertenschlanken Amant seine Acht-Gänge-Menüs verspeisen und dabei die Weltpolitik erklären sieht. Wie die widerliche französische Großfamilie voller Masochismus sonntägliche Kaffeetafeln auf Brokatsofas im Familienschloß inszeniert - diese Gesamtschau kultureller Fremdheit sagt mehr als jede amerikanisch-französische Konfrontation im Weltsicherheitsrat. Am Ende darf auch noch ein Brite in das Kauderwelsch der Tischsitten eingreifen und seine Nation blamieren. Schade, daß kein Schultze Ivorys Diners mit Zwiebelmettbrötchen beleben durfte.
Und was sagen die Italiener, immerhin die Gastgeber dieser Völkerschau, zu all dem? Ihre Gegenwart ist vor allem eine Vergangenheit, imprägniert von den Toten des Weltbürgerkriegs und des Terrorismus und den Illusionen all der Ideologien, die in Berlusconi einen würdigen Totengräber gefunden haben. Neben Bertoluccis Achtundsechziger-Träumern und einem noch ausstehenden Terroristenfilm von Marco Bellocchio über Aldo Moros Ermordung führte auch "Segreti di Sato" (Staatsgeheimnisse) von Paolo Benvenuti in die blutig belastete Vorvergangenheit der Republik. Hier geht es um ein Blutbad anläßlich einer kommunistischen Maifeier, bei der 1951 im sizilianischen Portella della Ginestra Dutzende Menschen ermordet wurden.
In einer veritablen juristischen Rekonstruktion hat der Regisseur die Staatsgeheimnisse aus den lange gesperrten Archiven hervorgeholt. Die Conclusio, die auch sogleich für beachtlichen Streit in Italiens Politik sorgte, war nicht überraschend: Kein Räuberhauptmann, noch nicht einmal die Mafia war für das Massaker verantwortlich, sondern wohl mit Granaten bewehrte Truppen aus dem antikommunistischen Lager von Christdemokraten, Vatikan und CIA. Nicht nur, weil mit Giulio Andreotti einer der Beschuldigten immer noch im politischen Alltag herumwabert, sondern auch wegen der unangenehm untoten Sympathien für Fasch-, Kommun- und Katholizismus sind die Italiener in diesem Punkt auch nach über fünfzig Jahren so merkwürdig sensibel. Das funktioniert natürlich nur, wenn man Christdemokratie oder Vatikan jemals als moralische Institutionen wahrnahm, was verwunderlich genug ist. Andererseits will man sich die Filme über jene Gemetzel von damals nicht vorstellen, die nach einem Sieg der Stalinisten heute zu beweinen wären. Ästhetisch hingegen sind dergleichen Projekte von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ermittlungsakten produzieren selten Bilder, die muffigen Gefängnisszenen riechen allerhöchstens nach "Graf von Monte Cristo", und ein Massaker, das andauernd mit Zeichnungen, Zigarettenschachteln und Spielkarten nachgestellt werden muß, ist für die mitfühlende Imagination verloren.
Die Liebe zu den Schafen.
Das Italien von heute ist ein Land, das sich nach dem proletarischen Wirtschaftswunder in eine Spaßgesellschaft verwandelt. Von diesem schmerzhaften Prozeß - von der Würde zum Klamauk, vom Landleben zur Metropole, von der Fabrik zum Strand - handeln die beachtlichen anderen Beiträge der Gastgeber. In "Il miracolo" erzählt Edoardo Winspeare von einer vermeintlichen Wunderheilung durch einen kleinen Jungen, die das Fernsehen zynisch ausschlachten will. Hier wird das häßliche Neubauviertelleben im apulischen Taranto ebenso zur Kulisse wie bei Salvatore Mereu ("Ballo a tre passi") die durchgedrehten Strandparties in Sardinien, bei denen sich ein Schafhirte nur mühsam in die Polonaise einreiht. Ihm sind die einsamen Berge lieber, aber auch dorthin verfolgt ihn eine nymphomane Touristin, bis sie schmerzlich lernen muß, daß der muskulöse Landmann die Liebe bisher wohl eher mit seinen Schafen praktizierte.
Auch "Liberi" (Freie) von Gianluca Maria Tavarelli handelt von der Migration provinzieller Proleten an die Küste. Vor der Arbeitslosigkeit aus Abruzzentälern geflohen, müssen sich die Protagonisten in den Strandbars von Pescara als Hilfsköche und Kellner verdingen. In einem solchen etwas pathetischen Alltagsfilm wird deutlich, welche Macht die sich zersetzenden Traditionen in diesem Italien immer noch ausüben: Die Kinder haften für ihre entwürdigten Eltern, welche Scheidung und Arbeitslosigkeit nicht verkraften. Doch da sind das echte und das cineastische Italien immer noch besser weggekommen als Deutschland. Ein Schultze war, ist und bleibt allein.
DIRK SCHÜMER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main



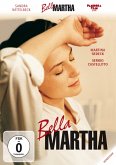
 FSK: ohne Alterseinschränkung gemäß §14 JuSchG
FSK: ohne Alterseinschränkung gemäß §14 JuSchG