Verräter oder Held. Was trieb Edward Snowden dazu, geheime NSA-Dokumente zu veröffentlichen? War ihm bewusst, welchen Preis er dafür zahlen würde? Oscar-Preisträger Oliver Stone bringt mit SNOWDEN das Leben des kontrovers diskutierten Whistleblowers Edward Snowden auf die große Leinwand und zeigt den Menschen hinter dem Mythos, der mit seinen Enthüllungen der Welt die Augen öffnete, dafür aber seine Karriere und Heimat aufgeben musste. Es ist die Geschichte eines normalen Mannes, der es nicht mit seinem Gewissen vereinbaren konnte, zu schweigen...
Bonusmaterial
Interviews mit Cast & Crew B-Roll Deutsche Hörfilmfassung
Auf dem Weg vom rechtschaffenen Konservativen zum patriotischen Verräter wird Edward Snowden in "Snowden" ein typischer Held für einen Film von Oliver Stone.
Oliver Stone hat einen Film über Edward Snowden gedreht, jenen ehemaligen Angestellten und später freien Mitarbeiter von NSA und CIA, der die Überwachungspraktiken der NSA in einem Hotelzimmer in Hongkong vor den Mikrofonen und Kameras des englischen "Guardian" und der Dokumentarfilmerin Laura Poitras offenlegte. "Citizenfour" hieß die Dokumentation, die Laura Poitras über den Fall gedreht hat (ohne selbst darin aufzutreten). Sie hat damit einen Oscar gewonnen.
"Snowden" heißt der Film von Oliver Stone, der auch Laura Poitras, hier gespielt von Melissa Leo, ein kleines Denkmal setzt, indem er sie als Figur auftreten lässt: gelassen, professionell, offenbar nicht zu erschüttern und ganz bei sich, während Glenn Greenwald vom "Guardian", gespielt von Zachary Quinto, deutlich panisch auf Geräusche auf dem Flur reagiert. Kommt die CIA und hebt sie alle aus, bevor die Geschichte in Druck geht? Sie kommt nicht, wie wir alle wissen, sonst wären die Dokumente nie ans Licht gelangt.
Anders als "Citizenfour" bleibt "Snowden" nicht im Hotel, aber der Film kehrt nach ausführlichen Rückblenden mehrmals dorthin zurück und erlaubt sich am Ende den Witz, den realen Edward Snowden, inzwischen in Moskau, in einer Überblendung selbst in den Film zu holen.
Wer das Werk von Oliver Stone kennt - seine Filme über den Vietnam-Krieg, seine Filme über amerikanische Präsidenten beziehungsweise ihre Ermordung oder ihren Niedergang, von "JFK", über "Nixon" zu "W." oder seinen Film über die Machenschaften an der "Wallstreet" -, der ahnt, wie sein Film über Snowden aussieht. Wie er sich anfühlt, anhört. Worauf er hinauswill. Und genauso kommt es: Die Figur Edward Snowden passt haargenau in diese Reihe von Männern, denen gemeinsam ist, dass sie sich einer existentiellen Auseinandersetzung stellen. Man könnte auch sagen, es geht in den Filmen von Oliver Stone immer um Männer in einem Kampf, der sie zu sich selbst führt. "Growing to manhood" hat Stone das einmal genannt. Man könnte auch sagen: wie sie wurden, was sie sind. Helden in gewisser Weise, die aus Enttäuschung an der Führung ihres Landes zu Rebellen wurden, sich damit aber als die besseren Patrioten erweisen. "Snowden" ist, so steht es auf einer Texttafel zu Beginn, eine "Dramatisierung tatsächlicher Vorgänge". Es geht los in Hongkong. Am 3. Juni 2013. Dort traf sich Snowden - Erkennungszeichen ist ein Zauberwürfel, den er in der Hand hält - mit den beiden Journalisten, um ihnen Dateien zuzuspielen, die bewiesen, dass die amerikanischen Geheimdienste die eigenen Bürger wie auch Regierungsangehörige von Verbündeten im Namen der Terrorismusbekämpfung flächendeckend abgehört haben. Dokumente, die auch beweisen, wie der Drohnenkrieg im Mittleren Osten geführt wird; wie mit Malware andere Länder im Cyberspace angegriffen werden.
In diesen Tagen hat ein amerikanisches Gericht den Vorwurf des Hochverrats gegen Snowden bekräftigt, der ihm dreißig Jahre Haft einbringen könnte. Das alles ist wichtig, aber wie wird daraus ein Film, der seine Zuschauer bei der Stange hält? Nur durch die Backstory, nur dadurch, was das Drehbuch an Hintergrund entwirft. Edward Snowden begann, so weiß es dieser Film, als aufrechter Konservativer, der zum Militär geht, um seinem Land zu dienen - wie einst Ron Kovic in "Geboren am 4. Juli". Snowden, gespielt von Joseph Gordon-Levitt in fast gespenstischer physiognomischer Ähnlichkeit, sieht aus wie der Nerd, der er ist, mit Brille im Bootcamp; das kann nicht gutgehen. Der Einpeitscher schreibt, der Nerd fällt in den Schlamm, so sieht das aus. Er bricht sich beide Beine, seine militärische Laufbahn, die er mit dem Einsatz im Irak krönen wollte, ist zu Ende.
Eine Frau, Lindsay Mills, die Shailene Woodley zunächst spitzbübisch spielt, bis sie von Regie und Drehbuch zur besorgten Gattin gemacht wird, bringt ihn dazu, Entscheidungen der Regierung, vor allem den Krieg im Irak, in Frage zu stellen. Aber mehr als diese Initialzündung gibt Lindsay nicht her. So wie Snowden ein typischer Stone-Held ist, ist Lindsay eine typische Stone-Frau am Rande, der er aber noch einen halbnackten Auftritt als Lehrerin für "exotic dance" spendiert.
Dass alle amerikanischen Studios das Drehbuch (das Snowden abgesegnet hat) zurückgewiesen haben und Stone sich in Europa, vor allem in Deutschland, mit Produktionsgeldern versorgen musste, hatte vermutlich tatsächlich vor allem politische Gründe. Dabei ist ganz unklar, ob das Kino als Ort, in dem politische Debatten angestoßen oder weitergetrieben werden, überhaupt noch funktioniert. Oliver Stone muss daran glauben. Er ist vor einigen Tagen siebzig Jahre alt geworden, warum sollte er sich plötzlich ändern? Die Zeit, in der er ein anderer war, ist lange vorbei. Ungefähr so lange wie sein erster Kriegsfilm "Salvador". Das war 1986. Mit diesem Film wurde er, was er heute immer noch ist - ein politischer Filmemacher, der Geschichten erzählt, die auch in den Kommentarspalten der großen Zeitungen, den Expertenrunden im Fernsehen, Blogs im Netz diskutiert werden. Aber er musste bis zur NSA-Affäre warten, um sagen zu können: Habe ich es nicht immer schon gesagt, dass die Regierung uns hinters Licht führt?
Der Makel der Helden von Oliver Stone ist ihre Makellosigkeit. Ganz können wir ihnen nicht glauben. Und ihm auch nicht.
VERENA LUEKEN
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main







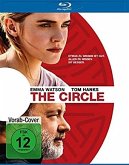

 FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG
FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG