Nicht lieferbar
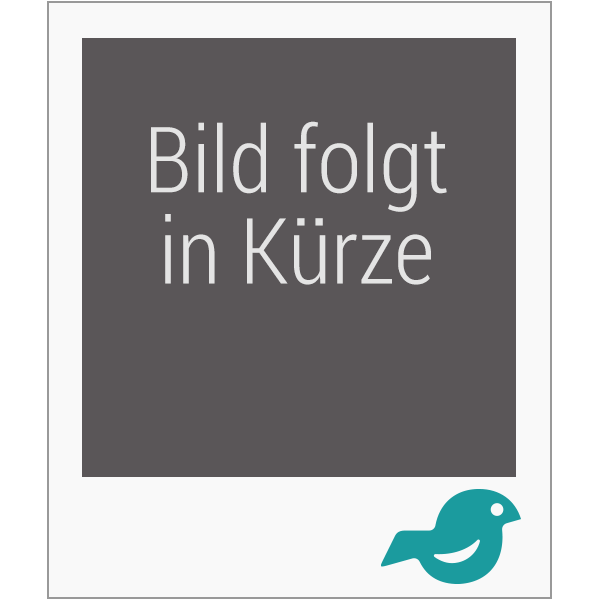
Spider
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Als einer der jüngsten Bewohner zieht der geistig verwirrte Spider in ein freudloses, von Hausmeisterin Wilkinson mit eherner Hand geführtes Londoner Männerwohnheim. Von dort aus unternimmt der kettenrauchende, ständig Unverständliches vor sich hin murmelnde Spider lange Spaziergänge in die Umgebung. Dabei versinkt er immer tiefer in die Erinnerungen an seine Kindheit, die ein schreckliches Ende fand, als sein Vater die Mutter ermordete und dessen Geliebte immer mehr Aussehen und Wesenszüge der Getöteten übernahm.




