Part 5 of the new series - BALLROOM DANCER - shows you how to dancejive & samba from the beginning to a professional status. The individual dancing steps are presented by a professional dancing couple as well as by a graphical design. Different perspectives even from above make learning jive & samba a very easy and entertaining experience. For advanced dancers there are also advanced combinations of impressing dancing steps. Finally a very easy and efficient menu navigation supports the idea of dancing jive & samba like a pro within a few days.

Späte Liebe, früher Tod, neuer Anfang: "Beginners", ein Film von Mike Mills
Kann man sich vorstellen, dass eine Frau einem schwulen Mann einen Heiratsantrag macht mit der Bemerkung "Das gibt sich schon"? Zur Entschuldigung der Frau, die sich und ihrem Mann damit fünfundzwanzig Jahre Unglück in der Ehe einhandelte, sei gesagt, dass das in den fünfziger Jahren war, als man noch glaubte, Homosexualität sei heilbar wie eine Krankheit. Dabei hatte die Frau auf anderen Gebieten durchaus unkonventionelle Vorstellungen. Zum Beispiel lehrte sie ihren Sohn, wie er möglichst fotogen zu Boden sinken könne, wenn sie ihn mit einem Schuss aus der Zeigefingerpistole und einem sanften "Poff" ermordete. Oder wie man sich in Avantgardekunstausstellungen danebenbenimmt. Irgendwann stirbt sie, und der Vater eröffnet dem Sohn, was die Mutter von Beginn an wusste. Er ist inzwischen fünfundsiebzig und stürzt sich lustvoll in die schwule Subkultur von Los Angeles. Dann wird auch er krank und stirbt. Sein Sohn erbt den Hund.
Mit dem Tod des Vaters (Christopher Plummer) fängt "Beginners" von Mike Mills an, mit leeren Räumen, einem winselnden Jack Russell und einem todtraurigen Sohn, Oliver, gespielt von Ewan McGregor. Und doch ist von den ersten Bildern an klar, dass wir nicht in den Untiefen familiärer Melodramatik werden herumwaten müssen, sondern auf intelligentere Weise mit den Figuren und ihrer Welt vertraut gemacht werden.
Wie Oliver lebt, sehen wir, wenn er dem geerbten Hund sein Haus zeigt. Wie einsam er ist, wenn er dem Hund im Park erklärt, er sei eigentlich ein Jagdhund, müsse sich aber nun mit einem Tennisball begnügen. Dass der Hund in Sprechblasen darauf antwortet, zeigt, dass dies eine glückliche Paarung ist - die einzige in diesem Film, die auf Anhieb gelingt.
Die Perspektive ist also die des Sohns, und wie das so geht, wenn die Eltern sterben, mäandern seine Gefühle wie seine Erinnerungen durch die Zeiten, nicht chronologisch, nicht immer im selben Stil, nicht immer in derselben Stimmung. Wir sehen Oliver als Kind zu Boden sinken, wenn die Mutter ihn "erschießt". Wir sehen ihn Jahrzehnte später seinen Vater pflegen. Wir sehen ihn bei der Arbeit als Illustrator, mit Freunden. Von denen lässt er sich überreden, zu einer Kostümparty zu gehen. Er verkleidet sich als Sigmund Freud, mit Perücke, Pfeife, Bart, und trifft auf eine stumme junge Frau mit schwarzer Bubikopfperücke, die ihm Zettel hinhält. "Kehlkopfentzündung" steht auf einem. Sie wird also später einmal sprechen, das ist eine Erleichterung, nicht nur für Oliver.
Mélanie Laurent war in Quentin Tarantinos "Inglourious Basterds" eine Entdeckung, und auch hier hat sie eine ungewöhnlich starke Leinwandpräsenz - charmant, geheimnisvoll, unsentimental, gerade so, wie Amerikaner sich eine Französin vorstellen. Mélanie Laurent muss sich dafür nicht verstellen, wie es scheint. Sie spielt eine Schauspielerin, was zeigt, dass die Filmemacher ihrem Bild von der Französin als Gegenentwurf zur pragmatisch-draufgängerischen Amerikanerin nicht ganz trauen und gern ein wenig auf ironischen Abstand von ihrer eigenen Phantasie gehen, eine wohltuende Haltung in einer Geschichte, in der an jeder Wendung eine Klischeefalle steht.
Die Strategie, immer wieder zurückzutreten von den Ereignissen und Figuren, erlaubt Mike Mills, ähnlich wie in seinem erstaunlich leichthändigen Debüt "Thumbsucker" vor einigen Jahren, ein ziemlich genaues Bild komplexer Verhältnisse zu zeichnen. Wobei die Verhältnisse sowohl familiäre als auch historische sind, beide bindungskräftig, aber nicht ausweglos.
VERENA LUEKEN
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
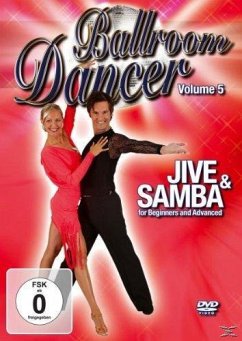


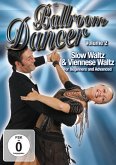




 FSK: ohne Alterseinschränkung gemäß §14 JuSchG
FSK: ohne Alterseinschränkung gemäß §14 JuSchG