Über zwei Jahrzehnte sind vergangen, seit Sarah Connor den Tag der Abrechnung verhindert und die Zukunft verändert hat. Doch der unerbittliche Krieg zwischen Mensch und Maschine geht weiter. Es wird ein tödlicher neuer Terminator des hochentwickelten Modells Rev-9 aus der Zukunft entsendet, um die zukünftige Anführerin des Widerstands aufzuspüren und zu töten.

Der sechste Film der "Terminator"-Reihe ignoriert die Teile drei, vier und fünf zugunsten einer gigantischen Karambolage zahlreicher Gegenwartsprobleme und Zukunftsaussichten: "Terminator: Dark Fate" ist ein Katalog der Körperpolitik für Menschen und Maschinen.
Die junge Mexikanerin Dani Ramos kann sich in mindestens drei Sprachen beschweren: auf Spanisch bei Bruder und Vater über deren Vernachlässigung von Alltagspflichten, auf Englisch beim wohl aus Nordamerika in Danis mexikanische Heimatmetropole entsandten Boss einer Hightech-Produktionsstätte, deren Arbeitskräfte auf Kapitalbefehl durch Automaten ersetzt werden sollen, und schließlich mit Löwinnengebrüll, wenn Killerapparate aus der Zukunft Dani oder ihre Lieben zerhacken, aufspießen und mit Kugeln bespucken wollen.
Natalia Reyes spielt diese Dani als zunächst widerwillige, dann schier unüberwindliche Heldin des (nach mehr oder weniger offizieller Zählweise) sechsten Spielfilms der "Terminator"-Filmreihe. Die Teile drei bis fünf werden hier ignoriert, "Dark Fate" will als direkte Fortsetzung der beiden ersten verstanden werden, "Terminator" (1984) und "Terminator 2: Judgment Day" (1991). Diese Filme hat James Cameron gedreht; ihr Ruhm ruht auf seinen und vier weiteren Schultern, nämlich den eckigen von Arnold Schwarzenegger als Tötungsmaschine und den etwas schmaleren von Linda Hamilton als Sarah Connor, die erst sich selbst und dann ihren Sohn John davor bewahren muss, vom kybernetischen Ausputzer einer künftigen Maschinenzivilisation "terminiert" zu werden.
Schwarzenegger und Hamilton tragen weiße Bürgergesichter durchs Bild, was seinerzeit nicht groß auffiel, weil es im Hollywoodkino kaum andere Gesichtersorten gab. Dani Ramos jedoch ist Latina, und das Antlitz des Killerautomaten, der sie in "Dark Fate" hetzt, gehört dem Latinokollegen Gabriel Luna, der im Actionkracherfach jüngst mit einer mitreißenden Bravourvorstellung als Ghost Rider in "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." glänzen durfte.
Mit der offensiven Latinisierung der Gut-und-Böse-Pole des neuen "Terminator"-Films trägt Hollywood (wie zuletzt schon mit der Besetzung mehrerer tragender Rollen in Sylvester Stallones "Rambo: Last Blood") einer demographischen Umwälzung Rechnung, die von der Stammwählerschaft des derzeitigen Präsidenten der Vereinigten Staaten bekanntlich verabscheut wird. Aufhalten kann diesen Wandel niemand: In der Politik dämmert sowohl bei den Republikanern (Marco Rubio) wie bei den Demokraten (Alexandria Ocasio-Cortez, latina fuerte) die neue Zeit herauf, in der Popkultur ist das Spiel schon seit Ricky Martin, Jennifer Lopez und Penélope Cruz gelaufen, und das Grusel-Unbewusste des weißen (Klein-)Bürgertums ergänzt seine alte Angst vor schwarzen Jugendlichen derweil, assistiert von Fox News, um die Furcht vor Kartellverbrechern, MS-13-Bandenmitgliedern (die Trump "Tiere" nennt), unzuverlässigen Hausangestellten und verschlagenen Schleppern.
All das ist in "Dark Fate" miteingebacken, unter einer sanft feministischen Glasur, die für diesen Storykontext nichts Neues darstellt (besonders deutlich herausgearbeitet hat den bewaffnet emanzipatorischen Anti-Automaten-Glamour der Sarah-Connor-Figur die Fernsehserie "Terminator: The Sarah Connor Chronicles" zwischen 2008 und 2009).
Verkauft der neue Film also kundenfangorientierte Ethno- und Geschlechter-Identitätspolitik? Proporzkommerz? Der Regisseur Tim Miller, der von Krawall genug versteht, weiß Bescheid darüber, worum es bei "Terminator"-Filmen zu gehen hat; er dient dem Rezept mit Apothekerredlichkeit: Hiebe und Stiche, Hubschrauber, Tanklöschfahrzeuge, Kollisionen, Ölschaden, Kurzschlüsse, Bergungsmanöver, Auffahrhumor, Quetschungen, Prellungen, Ballistik und Stacheldrahtkritik kommen zu ihrem Recht, ein paar Scherze von vornehm gezügelter Brillanz (Schwarzeneggers Figur nennt sich selbst mit steinerner Miene "extrem witzig") würzen den Braten. Vor allem aber räumen das Drehbuch (verfasst von David S. Goyer, Justin Rhodes, Billy Ray und diversen Stichwortgebern, darunter Cameron persönlich) und Millers Inszenierung alles aus dem Weg, was die Sicht auf die größte Stärke des "Terminator"-Bilderkosmos blockieren könnte: dass darin Leiber konkret vorführen, was sich zwischen Seele und Sachzwang abstrakt, in der komplett durchtechnisierten Welt der Gegenwart, dauernd sozial abspielt.
Hamilton und Schwarzenegger dürfen körperlich zeigen, was aus den Ideen wurde, für die sie vor rund dreißig Jahren standen: Sie sind teils verhärtet, teils verwittert, aber beide noch da. Ein als Kontrast zu Hamilton eingeführter junger Körper mit denselben ethnischen und Geschlechter-Merkmalen wie sie, der als Schauspielerin Mackenzie Davis und als Rolle "Grace" heißt, erinnert an Megan Rapinoe, Kapitänin der Frauenfußball-Nationalmannschaft der Vereinigten Staaten, muss aber, um ihre technische Selbstverbesserung nicht zu unterbrechen, andauernd Medikamente nehmen. Zwischen Aufladephasen und Kampfsport lebt sie daher genau so, wie die traditionelle Arbeitskraft der Trump-Stammwählerschaft, die von ihrem Idol die verlorenen Jobs wiederhaben will, derzeit lebt, nämlich zwischen Warterei auf Ausbeutung, Aufgeputschtwerden (etwa von Wahlveranstaltungen), Betäubungsmittelmissbrauch und Perspektivlosigkeit in der Ära von gig economy (Arbeit ohne Festanstellung) und jobless growth (selbst falls mal von "Hochkonjunktur" die Rede ist, gibt's keine neuen Stellen).
Man hat die "Terminator"-Filme stets missverstanden, wo man sie für reine Aufmarschgebiete männlich-faschistoid-militärischer Körperpanzer hielt, wie sie Klaus Theweleit durch Wilhelm Reichs biopolitische Brille bei urdeutschen Kriegsungeheuern erkannt hat. Schwarzeneggers und Stallones Muskeln erzählten im Achtzigerjahrekino zwar auch vom (Kalten) Krieg, ihre Hauptbotschaft war in der Ära von Reaganomics und Yuppie-Fitness aber eine ökonomische - die des Siegerindividualismus der Arno-Breker-Aufstiegspuppen an Darwins Wall Street. Die wichtigste, ganz im Sinn heutigen Wortgebrauchs "identitätspolitische" Antwort der Neunziger darauf war die von African Americans, die ihre Selbstermächtigung, während Ohnmächtige von obszön rassistischer Staatsgewalt kujoniert wurden (der "Fall Rodney King" ereignete sich 1991, im Jahr von "Terminator 2"), als Hip-Hop-Kultur zu organisieren und auch ökonomisch zu bestimmen lernten. Der seinerzeit gelegentlich von weißen Linksradikalen erhobene Vorwurf, hier würde ja nur der weiße gegen den schwarzen Kulturkapitalismus gesetzt, beeindruckte die Aktiven wenig: Wir sollen das nicht haben dürfen, was ihr, wenn eure wilde Jugend vorbei ist, selbstverständlich werdet in Anspruch nehmen dürfen, ein bürgerliches Leben, und ihr erwartet, dass wir euch die revolutionären Kastanien aus dem Feuer holen?
Am damals gegebenen Exempel pragmatischer kulturwirtschaftlicher Interessendurchsetzung orientieren sich auf vielfältig vermittelte Weise bis heute etwa der jüngere Chefetagen-PowerfrauenFeminismus, aktuelle Repräsentationskämpfe sexueller Minderheiten und teilweise auch die Protestkultur ums Einwanderungsthema. Alle diese Klientelbewegungen von Leuten, die, wenn man das Spiel Kapitalismus schon nicht abschaffen kann, wenigstens mitspielen wollen, werden jetzt jedoch zu Feindkollektiven im strategischen Denken und Handeln des rechten Populismus erklärt. Der dient sich Leuten an, die mit der Erosion ihrer Startpositionen im Kapitalismus-Spiel konfrontiert sind.
Wie verhalten sich Kämpfe derjenigen, die "aus einer anderen Zeit kommen" (oft heißt das nur: aus einer anderen, weniger entwickelten Gegend), zu hiesigen? Wer sich gegen das sträubt, was Mächtige wollen, muss fragen: Kann ich mit Leuten, mit denen ich nur eins gemeinsam habe, nämlich die Tatsache, dass man mich gegen sie und sie gegen mich hetzt, praktisch solidarisch sein? Was könnte Leute, denen es woanders zu blöd war, mit denen ins Gespräch bringen, die wissen, wie blöd es hier ist? Wahrscheinlich nicht mit sonderlich tief durchdachter Absicht, aber doch durchs Ansaugen von möglichst viel zeitgemäßem Zeug aus den Nachrichten (Menschenschmuggel, Drogenleid, Krieg), handelt "Dark Fate" von diesen Fragen - mal erhellend, mal verwirrend, mal sinnreich, mal euphorisch, mal traurig. Vieles, was alle angeht, indem es jeweils nur einige angeht, weil das Ganze so zerfahren ist, wird hier angerissen, einiges scharf, anderes stumpf. Was Tim Miller da abgeliefert hat, ist kein Meisterwerk für die Ewigkeit, aber ein sehr effizient bepackter, schöner neuer Anhänger für den bulligen Lastwagen, den James Cameron 1984 vom Band laufen ließ.
DIETMAR DATH
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main











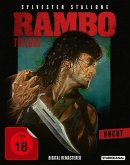


 FSK: Freigegeben ab 16 Jahren gemäß §14 JuSchG
FSK: Freigegeben ab 16 Jahren gemäß §14 JuSchG