Was haben BEN HUR und LAUREL & HARDY gemeinsam? Warum ist die Prügelei zwischen Montgomery Clift und John Wayne in RED RIVER eine der erotischsten Szenen der Filmgeschichte? Die Antworten und vieles, was Sie schon immer über das schwul/lesbische Hollywood wissen wollten, bietet der hinreißende, farbenprächtige, informative, himmelschreiend komische und tief bewegende Dokumentarfilm THE CELLULOID CLOSET. Die mehrfachen Oscar-Preisträger Epstein ("The Times of Harvey Milk") und Friedmann erlauben ausgesprochen amüsante Überlegungen zur Wahrnehmung von Lesben und Schwulen auf der Leinwand; mit höchster Präzision zusammengestellt und durch geistreiche Interviews bereichert u.a. mit Tom Hanks, Susan Sarandon, Whoopi Goldberg, Tony Curtis, Harvey Fierstein, Gore Vidal, Quentin Crisp und Shirley MacLaine, unterlegt mit unzähligen Filmclips von 1895 bis heute. Ein gelungener Streifzug durch die Filmgeschichte!
In "The Celluloid Closet" wagen Rob Epstein und Jeffrey Friedman einen Blick zurück in Hollywoods Filmgeschichte und widmen sich dabei ganz dem Thema Homosexualität im Kino. Zahlreiche sorgfältig zusammengestellte Filmszenen und Interviews mit hochkarätigen Stars geben aufschlussreiche und teilweise witzige Eindrücke zur Wahrnehmung und Darstellung von Schwulen und Lesben auf der Leinwand wider. Ein spannender, informativer und höchst unterhaltsamer Rückblick!
In "The Celluloid Closet" wagen Rob Epstein und Jeffrey Friedman einen Blick zurück in Hollywoods Filmgeschichte und widmen sich dabei ganz dem Thema Homosexualität im Kino. Zahlreiche sorgfältig zusammengestellte Filmszenen und Interviews mit hochkarätigen Stars geben aufschlussreiche und teilweise witzige Eindrücke zur Wahrnehmung und Darstellung von Schwulen und Lesben auf der Leinwand wider. Ein spannender, informativer und höchst unterhaltsamer Rückblick!
Bonusmaterial
DVD-Ausstattung / Bonusmaterial: - Kapitel- / Szenenanwahl - Interviews - Audiokommentare - geschnittene Szenen
Kann man vom Kino der DDR in heutiger Filmsprache so erzählen, dass ein gegenwartstaugliches Geschichtsbild herauskommt? Die Großproduktion "Traumfabrik" versucht es.
Im Sommer 1961 mochte man die Deutsche Film AG (DEFA) in Potsdam-Babelsberg beinahe mit Hollywood verwechseln. So sieht es jedenfalls für einen jungen Mann namens Emil Hellberg aus, der in diesen Tagen auf das Studiogelände kommt. Die Szene wirkt ein wenig, als würden gerade mehrere Monumentalfilme parallel gedreht, mit Kostümen, Kulissen, Komparsen und Getier aus allen Erdteilen. Emil stolpert zwischen exotischen Schönheiten herum, duckt sich neben Kamelen weg und weicht Explosionen aus. Er sucht Arbeit. Für einen Komparsen sieht er beinahe zu gut aus, zum Glück hat er Verbindungen, sein Bruder ist einer der vielen Mitarbeiter auf dem Gelände. Die Sache entwickelt sich allerdings nicht ganz nach Plan, denn Emil hat ein Talent dafür, sich in die Nesseln zu setzen. Auf das Kino umgelegt bedeutet das: Er taucht im Licht der Scheinwerfer auf, wenn es gerade nicht opportun ist.
Mit dem ganzen Aufwand, den Martin Schreier zu Beginn seines Films "Traumfabrik" treibt, bestätigt er seinen Titel und amüsiert sich zugleich darüber. Dass die DEFA aus der DDR es mit dem amerikanischen Kino aufnehmen könnte, wäre dann doch eine kühne Geschichtsklitterung. Zwar gab es seinerzeit eine ehrwürdige Tradition von Märchen- und Abenteuerfilmen, bei denen es aber niemals darum ging, einem Cecil B. DeMille ("Die Zehn Gebote") oder einem Joseph L. Mankiewicz ("Cleopatra") den Rang streitig zu machen. Die DEFA war ein sozialistischer Betrieb und suchte, wie der gesamte Staat, den sie mit ihren Filmen repräsentieren sollte, ständig nach Orientierung zwischen Klassenfeind und Massengeschmack, individuellem Ausdruck und offizieller Ideologie. Bei Schreier hingegen ist die DEFA vor allem der Ausgangspunkt für so etwas wie die "greatest German story ever told". Von Babelsberg ist es ja nicht allzu weit zur Glienicker Brücke, und damit zur deutschen Teilung.
Emil Hellberg bringt es als Tolpatsch vom Dienst gerade so weit in Babelsberg, dass er das Herz einer jungen Französin gewinnen kann: Milou ist als Assistentin und Double der französischen Diva Beatrice Morée vor Ort, sie ist also in einer ähnlich subalternen Position wie er. Zwischen Emil und Milou funkt es, zu einem zweiten Kuss kommt es aber nicht, denn ihre Verabredung wird in welthistorischem Format abgesagt: Milou wohnt im Hotel Savoy im Westen, am 13. August 1961 kann sie nicht mehr nach Babelsberg, von nun an trennt eine Mauer das geteilte Deutschland. Und Emil steht vor der Herausforderung, der Geschichte einen Streich zu spielen und der Liebe über die Systemgrenze hinweg Geltung zu verschaffen. Das ist tatsächlich ein Stoff, wie geschaffen für eine Traumfabrik. Die Frage ist nur: Wo steht sie wirklich?
Im deutschen Kino begann im Grunde bald nach der Wende eine Art Historikerdebatte darüber, wann die DDR aufhörte, ein Staat zu sein, um stattdessen als komische Veranstaltung weiterzumachen. Martin Schreier und der Drehbuchautor Arend Remmers markieren in diesem Zusammenhang nun einen naheliegenden Termin: Im Jahr 1961 wechselte die DDR das Genre, sie wurde lächerlich, indem sie sich einmauerte. Im Film wird dieser Übergang nicht zuletzt durch Emil selbst verkörpert. Er schafft es als Hochstapler, sich in Babelsberg zum Regisseur hochzudienen. Er stellt dabei die Bürokraten bloß, die vom Kino nur noch die Funktionärsebene begreifen, während Emil ein Bündnis mit den Veteranen des DEFA-Studiobetriebs schließt. Mit diesen Nebenrollen gelingen einige schöne Anklänge an eine Idee von Kino, für die das alte Hollywood zu Recht ein Modell war: ein Kino der "Handwerker", in dem ein Traditionswissen zum anderen passte und in dem Kunst gleichsam wie von selbst und aus dem gemeinsamen Tun entstand. Heiner Lauterbach als Studio-Chef Richard Beck ist hingegen eine klassische Charge, er spielt so, als müsste man durch ihn schon die Verspießerung der DDR unter Honecker erkennen können.
Die Konstellation des Mauerbau-Sommers interessiert "Traumfabrik" aber letztlich nur als Aufhänger für seine eigene Vorstellung von dem, was heutzutage Träume sein könnten. Und da erweisen sich Schreier und Remmers als Anhänger einer altmodischen Position: Es kommt vor allem darauf an, dass alles sehr viel größer ist als das Leben. "Bigger than life" kann eine Liebe nur sein, wenn ihr epochale Widerstände entgegenstehen. Und wenn sie auf Vorstellungen beruht, hinter denen eine Industrie steht. Eine solche Liebe ist vor allem ein Kompositum aus älteren Filmszenen, und Martin Schreier greift dabei nicht tief: Wenn man den nicht eben subtilen Soundtrack und die langwierige Dramaturgie als Richtschnur nimmt, dann hatte er nicht weniger als ein deutsches "Titanic" im Sinn. Dennis Mojen (erstmals aufgefallen 2009 in "Poll") in der Hauptrolle des Emil mag man dabei durchaus als aussichtsreichen Aspiranten in einer etwa auszulobenden Konkurrenz um den größten in Deutschland verfügbaren Leo-DiCaprio-Appeal sehen. Und Emilia Schüle ("Freche Mädchen", "Ku'damm 59") hat genau das Maß an Charisma, das für die Rolle der Milou angemessen ist: Sie ist ja eben keine Diva, sondern ein Mädchen in der Kulisse, das von einem großen Tanz träumt. Mojen und Schüle stehen für ein neues deutsches Starsystem, das den Vergleich mit anderen, längst durch Diversifizierung irdischer gewordenen Traumfabriken nicht mehr scheuen muss.
Mit ihrem Versuch, die historische Faktizität durch Romantik aufzuheben, haben sich Schreier und Remmers allerdings ein kaum zu lösendes Problem eingehandelt: Denn eine Liebesgeschichte zwischen Emil und Milou könnte sich ja zuerst einmal nur auf dem Gebiet der DDR erfüllen. Milou müsste also für die Liebe das Opfer der Freiheit bringen, ohne dass in "Traumfabrik" wirklich ernsthaft von der DDR die Rede sein darf, die eben nicht nur komisch war, sondern auch todernst. In den Film schreibt sich dieses Dilemma vor allem durch endloses Aufschieben ein: Schreier klappert alle möglichen Happy Ends ab, bis er dann endlich zu dem einen kommt, das im Grunde schon verspätet wirkt - in jedem Fall eher wie ein Trost für versäumte Höhepunkte.
Zugleich gibt er mit Michael Gwisdek in einer schwer erträglichen, weil über Gebühr kitschigen Rahmenhandlung in französischer Landhausidyllik das überglückliche Ende im Westen schon von Beginn an vor.
"Traumfabrik" verrät seinen Titel in nahezu jeder Hinsicht: Die Träume kommen aus keinem anderen Unbewussten als den geläufigsten Hollywood-Phantasien, die Fabrik weiß im Grunde nichts wirklich von der Produktion von Filmen. Vor allem aber geht das Spiel mit der Geschichte nicht auf: Deutschland sollte die Überwindung der Teilung nicht dafür zugefallen sein, dass man die hiesigen Traditionen nun an eine notdürftig ironisch gebrochene Überbietungsromanze ausverkauft.
BERT REBHANDL
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

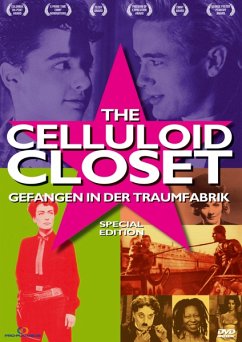


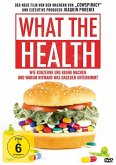



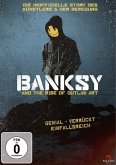
 FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG
FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG