Scott (Pete Davidson) war erst sieben Jahre alt, als sein Vater bei einem Einsatz als Feuerwehrmann ums Leben gekommen ist. Inzwischen ist er Mitte Zwanzig und hat im Leben nicht viel erreicht - sein Traum von einer Karriere als Tattoo-Künstler scheint in weiter Ferne zu liegen. Während seine ambitionierte jüngere Schwester (Maude Apatow) aufs College geht, wohnt Scott noch immer bei seiner überarbeiteten Mutter (Marisa Tomei). Sein Alltag besteht aus dem Konsum nicht immer legaler Substanzen, Abhängen mit seinen ebenso verpeilten Freunden und gelegentlichen Sex-Dates mit seiner Kindheitsfreundin Kelsey (Bel Powley). Doch als seine Mutter beginnt, einen großmäuligen Feuerwehrmann (Bill Burr) zu daten, löst das eine Kette von Ereignissen aus, die Scott zwingen, sich seiner Vergangenheit zu stellen und sein Leben selbst in die Hand zu nehmen.
Bonusmaterial
- Alternative Enden (die nicht funktioniert haben!) - Unveröffentlichte Szenen- Gag Reel- Line-O-Rama- Der Junge aus Staten Island- Judd Apatows Produktionstagebücher- Du bist nicht mein Vater: die Zusammenarbeit mit Bill Burr- Margie weiß Bescheid: die Zusammenarbeit mit Marisa Tomei- Freunde mit gewissen Vorteilen: die Zusammenarbeit mit Bel Powley- Geschwisterrivalitäten: die Zusammenarbeit mit Maude Apatow- Beste Freunde: die Zusammenarbeit mit Ricky, Moises und Lou- Papa: die Zusammenarbeit mit Steve Buscemi- Stand-up-Benefiz für Friends of Firefighters- Tribut an Scott Davidson- Wer ist Pete Davidson?- Die Feuerwache- Petes Castingideen- Petes Opa- Video-Anruf- Filmkommentar mit Regisseur, Co-Autor Judd Apatow und Schauspieler, Co-Autor Pete Davidson
Wie sieht der denn aus? Wie er will: Judd Apatows Komödie "The King of Staten Island" im Kino
Scott Carlin weiß seit acht Jahren, was sein Lebensinhalt sein soll: das Tätowieren. Da war er sechzehn und begann, die eigene Haut im Selbstversuch zu malträtieren. Nun ist der magere Oberkörper des Mittzwanzigers zur Leistungsschau seiner Leidenschaft geworden, allerdings muss man sagen, dass es sich dabei um eine eher unglückliche Liebe handelt. Scotts Plan, gemeinsam mit drei Slacker-Freunden ein Tattoo-Restaurant zu eröffnen, in dem die speisenden Gäste noch mehr blutiges Fleisch als nur auf dem Teller erhalten sollen, verkennt das eigene Können. In den Tattoo-Studios von Staten Island ist der junge Mann berüchtigt. Also lebt er immer noch bei seiner verwitweten Mutter in diesem langweiligsten der fünf Boroughs von New York. Als Verheißung fängt die Kamera bisweilen weit hinten auf der anderen Seite der Bay die Silhouette von Manhattan ein. Wenn er dorthin gelangte, wäre Scott Carlin der King. Er ist aber nur "The King of Staten Island".
So heißt der neue Film von Judd Apatow, den der 1967 geborene Regisseur gemeinsam mit dem mehr als dreißig Jahre jüngeren Stand-up-Comedian Pete Davidson geschrieben hat. Der spielt darin auch die Hauptrolle, und die Biographie von Scott orientiert sich an Davidsons Leben. Beide haben in früher Kindheit ihre Väter verloren, die als Feuerwehrmänner im Dienst starben. Beide leiden an Morbus Crohn, agieren aber so überdreht, als stünden sie permanent unter Drogen. Dieser Komödie ist also mehr als nur ein tragischer Zug eingewebt, und die Oberflächlichkeit von Scotts Freundeskreis (geschweige denn seines Liebesverhältnisses), die in den ersten zwanzig Minuten des Films von Apatow vorgeführt wird, soll wehtun. Lachen über Leiden (auch das eigene im Kino) - nach diesem Rezept funktioniert Hollywood-Komik seit jeher, der Boom an Peinlichkeiten, der auf der Leinwand seit einem Vierteljahrhundert herrscht, treibt das nur auf die Spitze. In der Peinlichkeit steckt die Pein ja mit drin.
Apatow hat dieser Erfolgsrezeptur kein Jota hinzugefügt. Und auch Davidson ist nicht mehr als nur ein weiterer Virtuose dieser Peinlichkeit, nur eben ein sehr junger, der damit genau die Zielgruppe anspricht, die den größten Teil der amerikanischen Kinogänger stellt. Für sie ist "The King of Staten Island" gemacht - ein kommerziell legitimes Verfahren, aber wer behauptet, hier würde sonst irgendetwas Neues geboten, dessen Gedächtnis reicht nicht weit zurück, oder er hat noch nicht viel gesehen. "The King of Staten Island" gleicht dem Oberkörper seiner Titelfigur: zahllose Versatzstücke und Zitate, aber letztlich doch nicht mehr als ein Panoptikum. Es wäre schön, wenn solche Filme einmal unter die Haut gingen.
Dieses Versäumnis muss den Spaß nicht mindern, vor allem nicht den am ersten Drittel des Films, wenn dessen recht schmales Personal zusammengeführt wird. Als Letzter stößt Ray Bishop dazu, ein schnauzbärtiger Glatzkopf, dessen abenteuerlustiger neunjähriger Sohn von Scott den Punisher in den Oberarm gestochen bekommen wollte, dann aber nach dem ersten Linienzug der Nadel weinend nach Hause rannte. Wie nicht anders zu erwarten, eskaliert diese Situation.
Wobei eine Eskalation sich bei Apatows Komödien stets auf der verbalen Ebene abspielt. Seine Helden sind natürliche Dampfplauderer, denen eine schlagfertige Replik ("Ich hielt ihn für achtzehn") viel leichter fällt als ein Schlag mit der Faust. Und auch Mr. Bishop erweist sich nach anfänglicher Erregung als eine Seele von Mann, der wie gerufen kommt, um die lange Einsamkeit von Scotts Mutter zu beenden - worauf deren Sohn endlich aus dem Haus hinaus muss. Marisa Tomei und Bob Burr zeigen als spätes Liebespaar, was Pete Davidson als Schauspieler noch zu lernen hat: Personen zu verkörpern, die über die eigene Persönlichkeit hinausgehen. Am Schluss geht sein Scott aber zumindest über die Grenzen von Staten Island hinaus.
ANDREAS PLATTHAUS
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

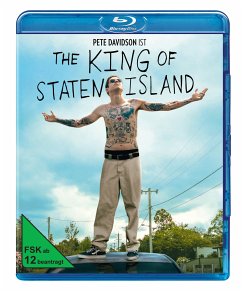




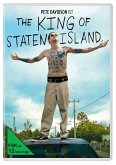

 FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG
FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG