In einer fabelhaften Welt, streng unterteilt in Haupt-, Nebenfiguren und Outtakes, steht Paula vor der wichtigsten Prüfung ihres Lebens: sie muss beweisen, dass sie das Zeug zur Hauptfigur hat. Paula will ein glamouröses Leben mit einer eigenen Storyline, aufregenden Szenen und voller Musik - nicht wie ihre Mutter, die als Nebenfigur im Hintergrund arbeitet. Sie ist Klassenbeste im Klippenhängen, beherrscht Zeitlupe und panisches Schreien im Schlaf - nur das Erzeugen emotionaler Musik will ihr einfach nicht gelingen. Auf der Suche nach einer Lösung, stößt sie auf Ungereimtheiten zum Tod ihres Vaters, einer heldenhaften Hauptfigur. Ihre Nachforschungen führen sie zu den verachteten, unterdrückten Outtakes, Menschen mit Filmfehlern, am Rande der Gesellschaft. Doch anstatt auf gefährliche Rebellen, trifft sie dort auf gebrochene Figuren mit echten Emotionen, die in einer ungerechten Welt versuchen zu überleben.
Paula beginnt zu zweifeln - an sich, an ihrem Platz in der Geschichte und an denen, die diese erzählen.
Paula beginnt zu zweifeln - an sich, an ihrem Platz in der Geschichte und an denen, die diese erzählen.

Filme, deren Blick auf die Welt am und im Filmwesen selbst ansetzt, gibt es oft. "The Ordinaries" ist aber ein ungewöhnliches Exemplar der Gattung.
Was für eine irre Welt: Im Film "The Ordinaries" kommt die Reinkarnation von Vierbeiner Lassie angetappst und fragt, wo ihr Gastauftritt stattfinden soll, die Murmel-und-Brabbel-Kino-Ikone Heiko Pinkowski gibt ein Kurzgastspiel als Kneipenrowdy, der nur mit übersteuerter Stimme grölen kann, und in derselben Kneipe dealt ein netter Typ, der sich abgehackt wie ein Jumpcut bewegt, mit Geräuschen in kleinen Fläschchen.
Denn in der Kaschemme namens "Bad Ending" versammeln sich die sogenannten Outtakes, Menschen mit Filmfehlern, die Abgeschobenen der Gesellschaft. "Keine unangemeldeten Plotpoints in diesem Bus!", meckert der Busfahrer einen Outtake an, der auf einem ihm verbotenen Platz sitzt.
In Sophie Linnenbaums Debüt sind diese Outtakes Menschen dritter Klasse. Die privilegierten Hauptfiguren hingegen residieren in Aristokraten-Villen und die Nebenfiguren in der Hochhausplatte, so auch Paula (Fine Sendel) und ihre Mutter (Jule Böwe).
Die 16-Jährige geht in die Hauptfigurenschule, sie ist Klassenbeste im panischen Schreien, wie sie einmal ohrenbetäubend unter Beweis stellt. Auch das Klippenhängen liegt ihr. Nur beim emotionalen Monolog, der Königsdisziplin für die Abschlussprüfung, hapert es: Sobald das Mädchen ansetzt, mit Kunstpausen und allem, was dazu gehört, dudelt die von ihrem Herzleser generierte, vor Kitsch triefende Filmmusik schief vor sich hin.
Paulas Monolog ist dem Vater gewidmet, einem, wie die Mama erzählt, tollen Hauptdarsteller, der dem Outtake-Mob zum Opfer gefallen sein soll und sich nun "zwischen den Schnitten" befindet.
Mit "The Ordinaries" beschließt die 1986 in Nürnberg geborene Regisseurin ihr Regiestudium an der Filmuniversität Babelsberg. Unglaublich, denn dieses Debüt, zu dem Linnenbaum gemeinsam mit Michael Fetter Nathansky das Drehbuch geschrieben hat, ist einer der originellsten deutschen Filme der letzten Jahre. Beim Filmfest München gab es dafür den Förderpreis Neues Deutsches Kino, beim First Steps Award die Auszeichnung für den besten abendfüllenden Spielfilm. Beim Deutschen Filmpreis ist "The Ordinaries" für das beste Szenenbild und die besten visuellen Effekte nominiert.
Im anachronistisch-zeitlosen Setting zwischen 1950er-Jahre-Look und retrofuturistischem Technikambiente feiert "The Ordinaries" im Cinemascope-Format das Kino und hält seinen Mechanismen spielerisch den Spiegel vor. Es wird gesungen und getanzt, in einem Krankenhaus übt Superman fliegen.
"Hier übe ich Angst", erklärt Paula einmal die ängstlich vibrierende Filmmusik, die dann einfach abreißt; einmal verselbständigt sich auch ein Voiceover-Kommentar. Metafilm-Klassiker wie "Die Truman Show" schauen um die Ecke, ein Junge sagt, dass er Tote sehen kann, in einer Szene sitzt ein Forrest-Gump-Verschnitt mit seinem Koffer an der Bushaltestelle, die sich dann tatsächlich als Kulisse entpuppt. Und sicher nicht zufällig erinnert Paulas Lehrer an Steven Spielberg.
Mitunter mit Spielbergscher Zuckerwattigkeit, aber nicht ironiefrei, wirft uns "The Ordinaries" hinein in einen Plot um Identitätssuche. Paula will mehr über den toten Vater erfahren und stolpert, nachdem sie im Institutsarchiv, in dem zu allen Hauptfiguren Daten gespeichert sind, nicht fündig wird, hinein ins verwahrloste Outtake-Viertel.
Begleitet wird sie von Outtake Hilde, einer sogenannten Fehlbesetzung, gespielt von Henning Peker im unauffälligen Dienstkleid. Hilde arbeitet als Hausmädchen bei ihrer besten Freundin Hannah (Sira-Anna Faal) und deren perfekt gestylten Eltern (Denise M'Baye und Pasquale Aleardi), beide Hauptdarsteller, die gerne ihre kitschigen Musical-Einlagen zum Besten geben.
Linnenbaum geht mit großer Fabulierfreude und Phantasie zu Werk und schafft den Spagat: "The Ordinaries" ist zwar ein Metafilm durch und durch, dabei aber alles andere als angestrengt oder anstrengend, eine so komplexe wie leichtfüßig daherkommende Wundertüte.
Hier schaukeln die Metaebene und diverse Referenzen einander spielerisch so hoch, wie das brutalistische Institut in den Himmel ragt, das im Film eine zentrale Rolle spielt. Der Film reflektiert die Spielarten des Mainstream- und Arthauskinos, die Filmgeschichte und die Gewerke des Mediums selbst. Mit tragikomischem Ton verschweißt der Film also Science-Fiction-Dystopie, Musical, Krimiplot und Familienaufarbeitung zu einer eigen- wie einzigartigen Melange, zu einem Film zwischen kinematographischem (Alb-)Traum und gesellschaftspolitischer Reflexion.
Denn was sich hier langsam herausschält, ist eine konsistent filmische Auseinandersetzung mit gegenwärtigen gesamtgesellschaftlichen Diskursen: mit Klassengrenzen und Rassismus, mit Zensur und der Bedeutung der Freiheit der Kunst. Die Hierarchien, die dieser Freiheit Grenzen setzen, sind in "The Ordinaries" klar: Figuren, die nicht in Raster passen, weil sie beispielsweise schwarz-weiß sind oder ihr Ton fehlerhaft ist, werden ausgegrenzt und in prekäre Umstände gedrängt.
Wer es dennoch wagt, den Mund aufzumachen, der wird mit einer Art Gesichtsstaubsauger, der an einen Inhalator denken lässt, zensiert und fristet fortan ein stummes Dasein mit einem Riesenpixel im Gesicht. Auch nicht renitente Nebenfiguren fristen freilich ein ödes Leben, in dem sie aussichtslos gefangen scheinen. Paulas Mutter geht einer langweiligen Nebenfigur-Tätigkeit nach und spricht emotionslos im begrenzten Nebenfigur-Wortschatz.
"The Ordinaries" veranschaulicht damit das sonst oft blasse Wort "Vielfalt" anders als mit Real-Abziehbildern und appelliert an die Kraft des (vermeintlich) Unperfekten, um darauf aufmerksam zu machen, dass das wahre Leben und die wahre Kunst eben genau diskontinuierlich "zwischen den Schnitten" passiert, zwischen den Oberflächen der berühmten 24 Bilder pro Sekunde.
Linnenbaums Debüt ist damit vor allem ein weiterer Beleg dafür, dass die vielen Zweifler am Wert des deutschen Gegenwartskinos genauer hinschauen sollten. Bei aller berechtigten und nötigen Verbesserungen den Weg weisenden Kritik am deutschen Filmförderungsgesetz, das allzu oft, mit Regisseur Edgar Reitz gesprochen, den "deutschen Gremienfilm" befördert und zu selten Platz für das Experiment, für formalästhetische Radikalität, für ein Kino lässt, das nicht bereits eingespielte Sehgewohnheiten bedient und nach lehrbuchgemäß dramaturgischen oder kommerziellen Musterrechnungen funktioniert: Der deutsche Film ist halt doch besser als sein Ruf, was sich nicht nur bei den inzwischen zumindest von der Kritik anerkannten üblichen Verdächtigen zeigt, sondern nicht selten beim Nachwuchs, der vom Radar der Fachwelt, aber auch des Publikums und des Marktes nicht erfasst wird.
Man achte in Zukunft stärker auf Regisseurinnen wie Annika Pinske, die mit ihrem Spielfilmdebüt "Alle reden übers Wetter" einen tollen Film über das Stadt-Land-Verhältnis gedreht hat. Auf Helena Wittmann, die gerade mit ihrem modernen Abenteuerfilm "Human Flowers of Flesh" das Erzählkino und den Experimentalfilm sinnlich verheiratet und damit Claire Denis' Klassiker "Beau Travail" eine Hommage gewidmet hat. Und jetzt auch auf Sophie Linnenbaum und ihre Imaginationsmaschine "The Ordinaries". JENS BALKENBORG
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main






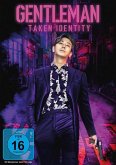


 FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG
FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG