Randy „The Ram“ Robinson (Mickey Rourke) ist ein Gladiator des Pop-Zeitalters. Als Wrestler (Catcher) feierten ihn früher die Fans in ganz Amerika. Doch der Preis dieses Ruhms war hoch: Der Star von einst ist ein Wrack, er hält sich mit Billigkämpfen für seine letzten, unverbesserlichen Anhänger über Wasser. Selbst mit der üblichen Dosis an Steroiden lässt sich der körperliche Verfall nicht mehr aufhalten.
Nach einem Herzanfall erkennt Randy endlich die Grenzen dieser Existenz: Der Einzelgänger nimmt Kontakt zu seiner lang entfremdeten Tochter Stephanie (Evan Rachel Wood) auf, findet in der Stripperin Cassidy (Marisa Tomei) eine Seelengefährtin und wagt die ersten Schritte in ein gewöhnliches Berufsleben. Doch Wrestling ist mehr als ein Job, den man einfach so ablegt, es ist ein Schicksal... Gilt auch für „The Ram“ die alte und brutale Ring-Weisheit: "Sie kommen nie zurück"?
Im Jahr 2008 ist Mickey Rourke ein unwahrscheinlicher Filmheld. Doch in „The Wrestler“, einer Geschichte über verprügelte Träumer und unbesiegte Verlierer, begeisterte er die Festivalgänger von Venedig 2008 so nachhaltig, dass ein kleines Beben durch die Filmwelt ging. Regie-Visionär Darren Aronofsky (“Requiem for a Dream”, “The Fountain”) erhielt den Goldenen Löwen indes nicht nur für seinen Besetzungs-Coup.
Ihm gelang ein moderner Klassiker über Liebe, Einsamkeit und den Lockungen der großen Bühne, denen man sich nicht entziehen kann. In weiteren Rollen überzeugen Evan Rachel Wood („Dreizehn“) und Marisa Tomei („Was Frauen wollen“).
Nach einem Herzanfall erkennt Randy endlich die Grenzen dieser Existenz: Der Einzelgänger nimmt Kontakt zu seiner lang entfremdeten Tochter Stephanie (Evan Rachel Wood) auf, findet in der Stripperin Cassidy (Marisa Tomei) eine Seelengefährtin und wagt die ersten Schritte in ein gewöhnliches Berufsleben. Doch Wrestling ist mehr als ein Job, den man einfach so ablegt, es ist ein Schicksal... Gilt auch für „The Ram“ die alte und brutale Ring-Weisheit: "Sie kommen nie zurück"?
Im Jahr 2008 ist Mickey Rourke ein unwahrscheinlicher Filmheld. Doch in „The Wrestler“, einer Geschichte über verprügelte Träumer und unbesiegte Verlierer, begeisterte er die Festivalgänger von Venedig 2008 so nachhaltig, dass ein kleines Beben durch die Filmwelt ging. Regie-Visionär Darren Aronofsky (“Requiem for a Dream”, “The Fountain”) erhielt den Goldenen Löwen indes nicht nur für seinen Besetzungs-Coup.
Ihm gelang ein moderner Klassiker über Liebe, Einsamkeit und den Lockungen der großen Bühne, denen man sich nicht entziehen kann. In weiteren Rollen überzeugen Evan Rachel Wood („Dreizehn“) und Marisa Tomei („Was Frauen wollen“).
Bonusmaterial
- Making of - Interview mit Mickey Rourke
Mickey Rourke ist "The Wrestler" in Darren Aronofskys Film
Der Mann hat fraglos bessere Zeiten gesehen. Früher füllte er als "Randy the Ram" mit seinen wuchtigen Attacken auf Gegner mit ähnlich phantastischen Namen den Madison Square Garden. Jetzt tritt er nur noch manchmal auf, in Turnhallen irgendwo auf dem Land, wo alles deutlich billiger ist als in der großen Stadt, die Wrestling-Kämpfe, die Gegner, ihre Methoden und die Erwartungen des Publikums. Randy the Ram, der gealterte Wrestler, hat noch einen Ruf, aber nichts mehr zu verlieren. Die Frage ist, ob er noch etwas zu gewinnen hat.
Das ist immer die Frage, wenn es um Comebacks geht, im Kino wie im Leben, und dass sich im Fall von Darren Aronofskys Film "The Wrestler" beides in der Figur von Mickey Rourke verbindet, der die Titelrolle verkörpert, ist natürlich der Clou des Films, über den ganz anders zu schreiben wäre, hätte nicht Rourke diese Rolle gespielt. Wenn man sich das vorstellt, werden die Schwächen von Aronofskys Film offensichtlich - dass er nämlich auf einem Klischee aufbaut, auf das sich andere Klischees (von der Hure mit dem goldenen Herzen, der verlorenen Tochter, dem Beinahe-Herzstillstand als Präludium des glücklichen Ausgangs) häufen.
Andererseits war der Film nie mit einem anderen Darsteller als Rourke geplant, und deshalb konnte Aronofsky all diese Klischees riskieren, deren Lebenshaltigkeit ja nicht zu leugnen ist. Und "The Wrestler" wird mit dieser Besetzungsentscheidung zur schmerzhaften Geschichte eines Mannes, der versucht, in ein Leben zurückzukehren, von dem er sich bereits verabschiedet hatte, und dessen Sehnsucht nach diesem alten Leben, von dem er spürt, das es das einzige ist, das es ihm wert scheint, es überhaupt zu führen, so stark ist, dass er es sich zurückholt.
Wie Mickey Rourke es mit diesem Film ebenfalls tut. Er hatte seine Karriere als supertalentierter Darsteller cooler schöner junger Männer, die in den achtziger Jahren mit "Body Heat" begann und mit "Diner" und "Rumble Fish" einen sehr frühen Höhepunkt gefunden hatte, angewidert, arrogant, stinkfußhaft und bewusst weggeworfen, er hatte seine Texte nicht parat, seine Regisseure beschimpft und tätlich angegriffen und auch sonst so ziemlich alles veranstaltet, sich zur Persona non grata im Filmgeschäft zu machen. Seine Selbstzerstörungswut war immens, seine Liebe zu einem heroinsüchtigen Model herzzerreißend, und als wolle er erreichen, dass sein Äußeres diesen inneren Katastrophen angemessen Ausdruck verleihe, ließ er sich in Profi-Boxkämpfen, die er der Beschäftigung als Schauspieler nun vorzog, das Gesicht zerschlagen und so stümperhaft wieder zusammenflicken, dass seine Visage für die Leinwand mehr oder weniger untauglich wurde. Die Rollen, die er annahm, waren entsprechend mies, und so spielte er sie auch. Bis vor ein paar Jahren Frank Miller und Robert Rodriguez ihn in einer allerdings kleineren Rolle in ihrer Comic-Verfilmung "Sin City" besetzten - da sah man plötzlich wieder, dass Rourke eine Präsenz hat, die immer noch erstaunlich ist. Jetzt ist er also "The Wrestler", und im doppelten Sinn ist das die Rolle seines Lebens. Sein eigenes Comeback in die erste Schauspielerliga - mal sehen, was daraus wird.
Sein Haar ist lang, speckig, hausgebleicht, sein Haut hat die orangefarbene Ledrigkeit aus dem Solarium, seine Muskeln sind gewaltig, aber auch eingebettet in das Fett der späten Jahre und der Biere. Der Vermieter seines Wohnwagens hat gerade die Schlösser ausgewechselt, weil er die Miete nicht bezahlt hat. "The Wrestler" zeigt uns zu Beginn nicht nur einen Mann, der ziemlich am Rand seiner Existenzmöglichkeiten entlangschrappt, sondern auch die ärmliche Lebenswelt des provinziellen Amerikas jenseits der Speckgürtel, und er bleibt konsequent in dieser Welt, zu der die schlecht beleuchtete Go-go-Bar gehört (wo Marisa Tomei als nicht mehr ganz junge alleinerziehende Stripperin arbeitet), der Altkleiderladen, die antiken Gameboys, Telefonzellen, die auch benutzt werden, und klapprige Fahrzeuge.
"The Wrestler" zeigt aber noch etwas anderes. Er zeigt einen Mann in latexenger Berufsverkleidung, wie er beim Blondieren über dem Waschbecken und bei der Rasur der Körperhaare eine Männlichkeit zu behaupten sucht, die er selbst nur noch als Travestie und krachende Parodie im Ring sichtbar machen kann. Aronofsky hat also nicht nur einen Film über den Wrestler und in gewisser Weise über Mickey Rourke gedreht, sondern auch einen Film über verlorengegangene Konzepte eines Machismo, der keinen Ort mehr findet. Man muss das nicht bedauern, und wenn man Rourke in den vergangenen Wochen zusah, wie er seine Preise für diese Rolle einsammelte, wie lässig er sich gab, wie zeitverloren er sich anzog, wie er sprach, flirtete und schlucken musste, wenn er vom Tod seines Chihuahua Loki erzählte, hatte man auch nicht den Eindruck, dass er selbst das tut, sondern eher, dass er diese Ortlosigkeit jenseits strahlender Männlichkeit akzeptiert hat, die er jetzt sein Zuhause nennt.
VERENA LUEKEN
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

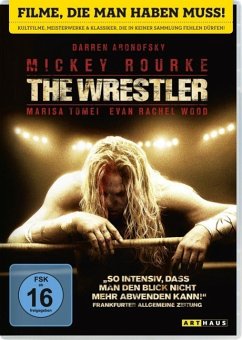


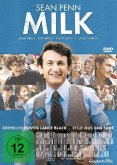


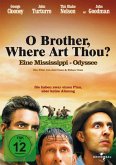

 FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG
FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG